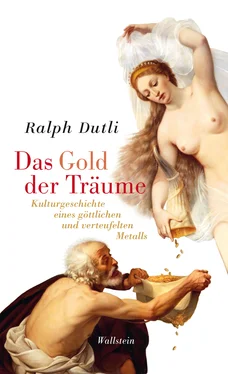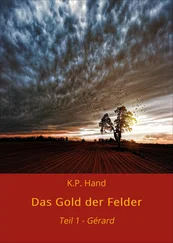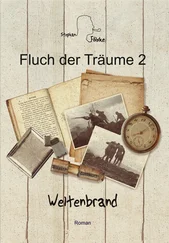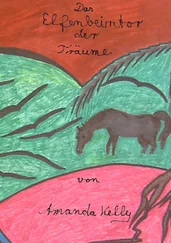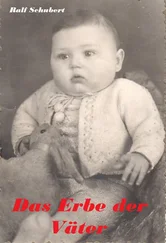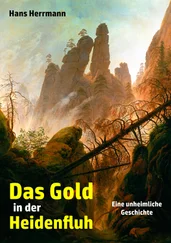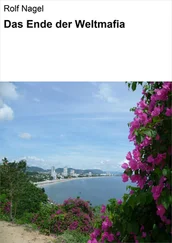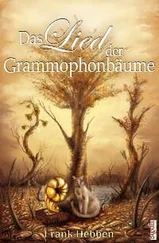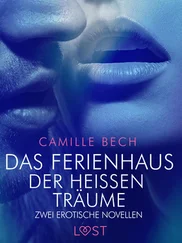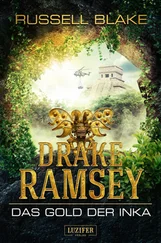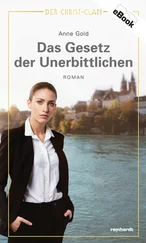Eine aus der oberägyptischen Stadt Nechen stammende Kleinskulptur des falkenköpfigen Gottes Horus aus der 6. Dynastie (2347 bis 2216 v. Chr.) gilt als das älteste erhaltene Werk ägyptischer Goldschmiedekunst. Der älteste Goldschmuck der Welt kommt jedoch nicht aus Ägypten, sondern aus Osteuropa, er ist noch zweitausend Jahre älter als das Alte Reich, wird auf 4600 v. Chr. datiert und stammt aus einem 1972 entdeckten neolithischen Gräberfeld im bulgarischen Warna am Schwarzen Meer, wo über dreitausend goldene Schmuckstücke aus der Erde gehoben wurden. Die Kulturgeschichte des Goldes umfasst also sieben Jahrtausende. Auch wenn die Pharaonen im »Haus der Millionen von Jahren«, also in der Ewigkeit, weiterleben wollten, ist auch die Sieben mit den drei Nullen schon eine respektable Zeitspanne.
Unverkennbar war Gold ein zentrales Element des Totenkultes. Als prächtige, unvergängliche Grabbeigabe begleitete es sumerische und babylonische Herrscher wie ägyptische Pharaonen ins Jenseits, Gilgameschs Gefährten Enkidu ebenso wie den jung verstorbenen Pharao Tutanchamun. Als Kranz aus stilisierten goldenen Olivenbaumblättern schmückte es in der Antike zahllose vornehme Häupter in den Gräbern des Mittelmeerraums. Auch das Gold der Skythenfürsten, der kriegerischen Reiternomaden, die sich in den Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung von der Mongolei bis ans Schwarze Meer mit goldenen Grabbeigaben bestatten ließen, beflügelte die Phantasie der Menschen.
Bei einem russischen Dichter der Moderne blitzt es noch in einer Vision des 20. Jahrhunderts auf: bei Wladislaw Chodassewitsch, geboren 1886 in Moskau, gestorben 1939 in Paris, in dessen Gedicht Gold vom 7. Januar 1917 (zum Gedicht) . Es entstand zu Beginn eines Jahres, das in Russland gewaltige historische Umwälzungen sah, und beschwört in Verkennung alles Zeitgemäßen archaische Bestattungsriten und Grabbeigaben: »Gold in den Mund, den Honig und den Mohn / In deine Hände – letzter Erdenmühe Lohn.«
Ein Dichter träumt die Möglichkeiten des Weiterlebens: in der bescheidensten irdischen Form – als Gras, oder im Kosmos – als Stern. Er glaubt an die Unsterblichkeit der Seele, die mit dem Edelmetall Gold assoziiert wird. Allein die Seele, das Goldstück im vergänglichen menschlichen Körper, soll als »kleine Sonne« überdauern, alles andere ist vergänglich: »Verwesen wird im Grab Honig und Mohn, / Die Münze fällt im toten Mund hinunter schon … / Doch nach so vielen dunklen Jahren legt / Ein Unbekannter seine Hand an mein Skelett, / Im schwarzen Schädel, den der Spaten bricht, / Klingt auf die schwere Münze und das Licht / Glänzt zwischen Knochen hell vom Gold / Als kleine Sonne – Spur, die meiner Seele folgt.«
Wer wird hier bestattet? Ein Nachkomme der Skythen? Es war für einen Russen leicht, Skythengold zu besichtigen. Zar Peter der Große besaß eine »Sibirische Sammlung«, Zar Nikolaj I. machte 1852 die Schätze in der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg öffentlich zugänglich. Doch was bedeuten die symbolischen Grabbeigaben, mit denen dieser Mensch bestattet werden will? Honig, Mohn, Gold. Sonst nichts: keine Keramik, kein Schmuck, keine Waffen, weder Bronze noch Eisen. Süße Nahrung für das Jenseits, wie in vielen Kulturen – kein Pharao trat seine »Nachtfahrt« ohne Honigtöpfe, Honigkuchen an. Dazu Schlafmohn, die Pflanze, die Rausch, Schmerzlosigkeit und Vergessen versprach.
Und schließlich das Metall der Ewigkeit, jeder Verwitterung trotzend, unversehrbar durch die zerstörerische Macht des Sauerstoffs. Kein anderes Metall könnte die Unsterblichkeit der Seele besser symbolisieren als Gold. Der Tote trägt gleichsam eine Variante der Charonsmünze im Mund. Aber wenn der Obolus bei den Griechen dem Verstorbenen vor der Bestattung unter die Zunge gelegt wurde als Fährgeld für Charon, damit er den Toten über die Unterweltflüsse in den Hades bringen sollte, so ist es in diesem modernen russischen Gedicht ein Eintrittsgeld in die Unsterblichkeit, ein Pass für das Weiterleben der Seele.
Im Jahr der geschichtlichen Umwälzungen 1917 beschwört ein russischer Lyriker den ewigen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Er träumt von dem, was bleiben soll, von der Seele und deren Unsterblichkeit. Vor dem Hintergrund von Weltkrieg und Revolutionen strahlt das Gedicht goldgleich eine starke Zuversicht aus: dass im historischen Chaos nicht alles verlorengeht.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.