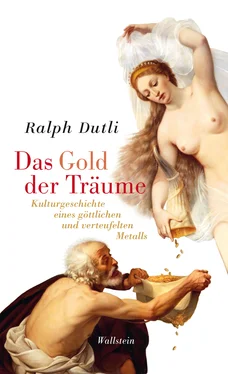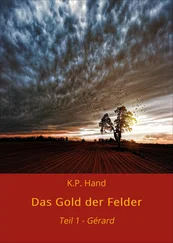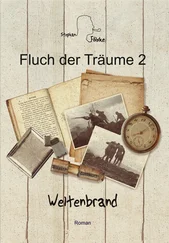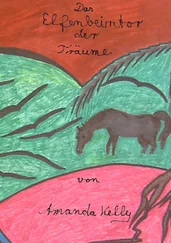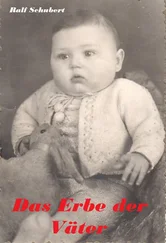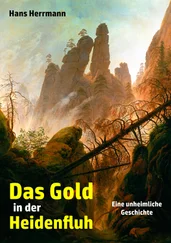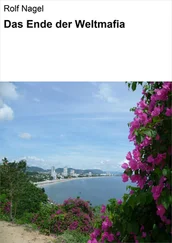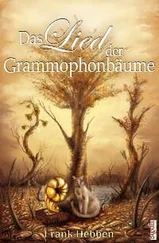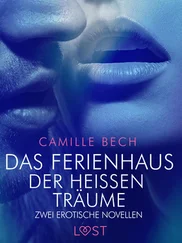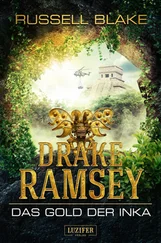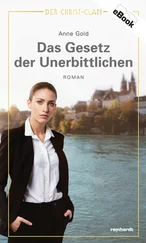Die idyllische Sutter’s Mill ist heute ein Nationalheiligtum, trägt den stolzen Namen Marshall Gold Discovery State Historic Park und gehört zu den gehätschelten staatlichen Parks Kaliforniens. Schließlich hat die bescheidene, vom Zimmermann Marshall errichtete Sägemühle Geschichte geschrieben. Goldgier gehört zur Geschichte des amerikanischen Kontinents, sie ist Teil des Gründungsmythos der Vereinigten Staaten wie jene Passage vom »Streben nach Glück«, pursuit of happiness, das die amerikanische Verfassung jedem Bürger zuerkennt.
Johann August Suter erlitt als gedemütigter Kaiser von Kalifornien einen spektakulären Ruin, doch fand er als tragische Figur Eingang in die Werke erstrangiger Schriftsteller. Stefan Zweig setzte ihm in der Erzählung Die Entdeckung Eldorados ein Denkmal, das er 1929 in die berühmte zwölfteilige Sammlung Sternstunden der Menschheit aufnahm. Zweig verhehlt weder die euphorischen Aufschwünge noch den tragischen Abstieg, die das Schicksal des berühmten Kolonisten bestimmten. Vom »Kaiser« zum »enttäuschtesten Bettler dieser Erde«, wie Zweig ihn nennt, der vor Drastik nicht zurückschreckt: »Der Rush, der menschliche Heuschreckenschwarm, die Goldgräber. Eine zügellose, brutale Horde, die kein Gesetz kennt als das der Faust, kein Gebot als das ihres Revolvers, ergießt sich über die blühende Kolonie.«
Ein eindrucksvolles Monument für Suter schuf auch dessen Schweizer Landsmann, der 1887 in La Chaux-de-Fonds geborene, 1961 in Paris verstorbene Dichter Blaise Cendrars, indem er ihm 1925 einen ganzen Roman widmete, der zu einem Welterfolg wurde. Der Dichter Yvan Goll übersetzte ihn und machte ihn auch im deutschen Sprachraum berühmt: Gold. Die fabelhafte Geschichte des Generals Johann August Suter. Cendrars, unter seinem richtigen Namen Frédéric-Louis Sauser, war ein helvetischer Weltenbummler und Abenteurer. Im Ersten Weltkrieg verlor er seine rechte Hand, als er als Fremdenlegionär auf französischer Seite kämpfte. In »General Suter« muss er einen lohnenden tragischen Abenteurer gewittert haben. In seinem Gold- Roman gibt es einen Brief Suters, in dem er die Katastrophe, die auf ihn niederbrach, zu verstehen versucht: »Nach diesem Spatenstich verließ mich alles … Das Gold aber ist verflucht und alle, die herkommen, um es zu suchen, sind verflucht, denn die meisten verschwinden, niemand weiß wie. Alle diese letzten Jahre war das Leben hier eine Hölle. Nur noch Mord, Totschlag und Diebstahl. Es gab niemanden, der sich nicht auf Räuberei verlegt hätte. Viele sind verrückt geworden oder haben Selbstmord verübt. Und das alles für Gold, dasselbe Gold, das sich nachher in Schnaps verwandelt und Gott weiß in was nachher … Das Tier der Apokalypse geht im Lande um und jedermann ist voller Erregung … Ich war der reichste Mann der Welt, das Gold hat mich ruiniert.«
Das Tier der Apokalypse – eine wahrlich dramatische Bezeichnung des Goldfiebers. Am Schluss in religiösen Wahn verfallend, lallt in Cendrars’ Roman der bald sterbende Schweizer Kolonist, der alles verloren hat, aufreibende Prozesse führen muss und schließlich nur noch die umstehenden Straßenkinder beschenken will, die Worte: »Wenn ich gewinne … gebe ich euch all das Gold, das mir zukommt, ein gerechtes, ein gereinigtes Gold. Gottes Gold.« Und Blaise Cendrars’ Roman endet mit den Worten: »Wer will Gold? WER WILL GOLD?«
Am kalifornischen Gold klebten so viel Schmutz und die Spuren roher Gewalt, dass der Traum vom »gerechten« und »gereinigten« Gold wie ein tiefer Wahn anmuten muss. »Gottes Gold«? Wie könnte das götzenhaft verehrte und begehrte Gold je wieder neu und rein werden nach dem kalifornischen Inferno? Was bleibt, sind die literarischen Spuren bei Zweig und Cendrars – beide fasziniert vom Phänomen des Goldrauschs, bei dem der Mensch dem Menschen als gieriger Wolf erscheint.
Aber lassen wir einen Schriftsteller nicht unerwähnt, der tatsächlich bei einem Goldrausch dabei war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er immerhin der meistgelesene Autor der Welt, seine Abenteuerromane Ruf der Wildnis (1903) und Wolfsblut (1906) erreichten Millionen lesehungrige Jugendliche und vom Aufbruch in die Wildnis träumende Erwachsene: Jack London (1876 bis 1916). In San Francisco geboren, in bitterer Armut aufgewachsen, schuftete er schon als Kind für zehn Cent die Stunde in einer Konservenfabrik, war Austernpirat, Robbenjäger, Kohlenschaufler. London nahm 1897 am gewaltigen Goldrausch am Klondike River teil, er litt schwer an den Strapazen der Goldschürferexistenz, erkrankte an Skorbut und musste völlig mittellos nach Kalifornien zurückkehren. Der von ihm ergatterte Goldstaub erbrachte ganze vier Dollar fünfzig. Die einzige Goldmine, die er fortan ausbeuten konnte, waren seine eigenen Erlebnisse in den autobiographisch grundierten Romanen Lockruf des Goldes (1910) – sein erfolgreichstes Buch – und Alaska-Kid (1912).
Aber wer hätte sich ausmalen können, dass das Thema des kalifornischen Goldrauschs noch bis in die Gegenwartsliteratur gelangen könnte? Der Büchner-Preisträger Jan Wagner feierte am 26. Juni 2017 eine Premiere. Sein Hörspiel Gold. Eine Revue wurde auf der Bühne eines Frankfurter Theaters uraufgeführt, danach mehrmals in Rundfunkanstalten ausgestrahlt und als Hörbuch veröffentlicht . Es ist ein »lyrisches Stimmenspiel« mit packenden Musikeinlagen à la Dreigroschenoper zwischen Goldgräbern und Glücksrittern in einem der über Nacht entstehenden Städtchen in Kalifornien zur Zeit des Goldrauschs. Wagners Stimmenspiel ist die »Revue zum Rausch«, in der »die Lebenden und auch die längst vergessenen Toten, verscharrt in der Erde, ein letztes Mal reden dürfen, so wie auch das Gold, das bleibt, während die, die es suchten, vergingen«. Und auf den Punkt gebracht vom Dichter selbst in einem kompakten klassischen Vers: »Wo nichts von Dauer ist, bin ich noch da und bleibe.« Es ist das Gold, das spricht.
Der Goldrausch ist also radiophonisch bis in die Gegenwartsliteratur vorgedrungen, weil sich in ihm Menschliches-Allzumenschliches kristallisiert und bricht, Lust und Gier und Verderben und Verfall. Goldrausch als repräsentatives Phänomen der Menschheit. Warum aber steht er zu Beginn dieser Umschau in der Kulturgeschichte des Goldes? Weil das irrationale Element in seinem Wesen – Maßlosigkeit, Gier, Fieber, Rausch und Wahn – nicht zu leugnen, nicht zu verdrängen ist. Weil Gold menschliche Abgründe offenbart, eine unwiderstehliche Lockung darstellt, die zu Abstieg, Verkommenheit, Verelendung führen kann. Ein Gang durch die Kulturgeschichte des Goldes bedeutet immer eine doppelte Geschichte – von Glanz und Gier, Höhenflug und Absturz.
Krisengeld gegen Krypto-Gold
Gold ist ein ganz realer Stoff, sichtbar, betastbar, eher geschmacklos, sicher geruchlos. Das ist natürlich ironisch gemeint, denn in einer Epoche der digitalen Kryptowährungen scheint die Bemerkung nicht überflüssig. Von ihren Adepten werden sie als »digitales Gold« bezeichnet, was wohl eher eine Majestätsbeleidigung für das göttliche Metall sein dürfte. Auch sprachlich ist es eine Flunkerei. Aber ist nicht auch die Bezeichnung »Betongold« für Immobilienbesitz ein irres Paradox? Beton ist Beton. Doch Gold scheint sich auch als patent gebräuchliche Metapher in diversen Bereichen anzubieten. Schwarzes Gold (Erdöl, Kaviar, Trüffel), weißes Gold (Salz, Lithium, Porzellan), grünes Gold (Olivenöl), blaues Gold (Solarzellen), rotes Gold (Safran) usw.
Die Verächter der Kryptowährungen betrachten sie als bloßes Spielgeld ohne inneren Wert oder Wertbeständigkeit, ungedeckt und schwindsüchtig. Als einen aus dem Nichts geschaffenen, puren Wahn. Von hoher Volatilität, bei der immerzu der endgültige Absturz drohe. Die kopflose »Krypto-Vergottung«, sagen sie, werde in die Hölle alias den Totalverlust führen. Tatsächlich scheint ihnen nicht einmal religiöses Vokabular abwegig. Ein bloßer Spuk, der vorbeigehen werde. Sie seien kein Wertaufbewahrungsmittel, kein Wertspeicher wie das gute alte Gold. Als »Rattengift hoch zwei« bezeichnet der amerikanische Großinvestor Warren Buffett die Kryptowährungen. Das neue Phänomen scheint auch die Metaphernprägungen zu beflügeln.
Читать дальше