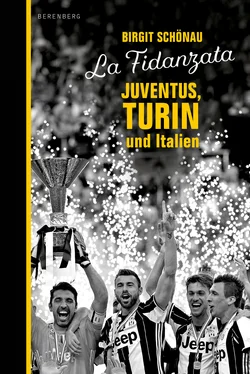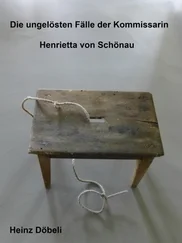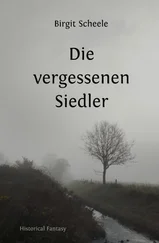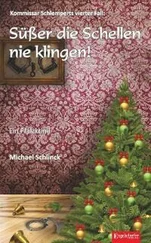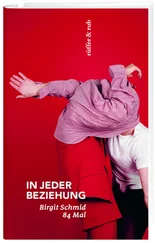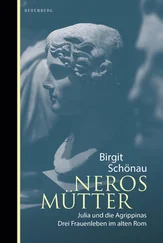Nach dem Mord an dem sozialistischen Oppositionsführer Giacomo Matteotti am 10. Juni 1924 durch ein faschistisches Killerkommando forderte der Verleger und Senator Luigi Albertini den späteren Staatspräsidenten Luigi Einaudi auf, einen Artikel zu verfassen, »damit Zyniker wie Giovanni Agnelli mal darüber nachdenken, was sie anrichten.« Ungerührt unterstützte der Industrielle indes im Senat eine Regierung, die nun offen in Richtung Diktatur steuerte. Fiat produzierte zu dieser Zeit rund 25.000 Autos im Jahr, die Leistungs- und Profitkurve ging beständig nach oben. In so gut wie jeder Turiner Familie arbeitete jemand für das kontinuierlich expandierende Werk, das dem Patriarchen jede Messe wert war – auch das Requiem für die parlamentarische Demokratie. Zum Dank gewährte der Diktator dem Industriellen den Auftrag zum Bau der Autobahn Turin-Mailand.
Sicher, die persönlichen Beziehungen zwischen Mussolini und Agnelli blieben kühl. Man brauchte sich und verabscheute einander auf das Gründlichste, allzu unterschiedlich waren der temperamentvolle Egomane aus der Romagna und der soldatisch strenge Unternehmer aus dem Piemont. Der Duce ließ das Telefon des Fiat-Patrons abhören, er verdächtigte den Industriellen antifaschistischer Händel. Agnelli konnte nicht verhindern, dass einer der Hauslehrer seiner Enkel wegen umstürzlerischer Umtriebe verhaftet wurde. Als er Franco Antonicelli eingestellt hatte, wusste er genau, dass dieser Intellektuelle ein Antifaschist war. Antonicelli führte die Agnelli-Kinder an Kafka und James Joyce heran, bevor die Faschisten ihn zwei Jahre lang in die Verbannung schickten. Als die Deutschen Italien besetzten, wurde Antonicelli Anführer der Resistenza im Piemont. Und erinnerte sich daran, dass er im Hause Agnelli stets korrekt behandelt worden war.
Giovanni Agnelli war ein Patron der alten Schule. Gegenüber seinen Angestellten wollte er allein das Sagen haben, schließlich wurden sie ja nicht von Mussolini bezahlt. Dennoch musste der Industrielle, als 1939 zur Fertigstellung des riesigen Mirafiori-Werks der Duce wiederum Fiat einen Besuch abstattete, einen Kotau vollziehen. Fast 50.000 Arbeiter beschäftigte Agnelli damals, und doch konnte er es sich nicht mehr erlauben, den stolzen Patriarchen zu geben. Stattdessen bat er um staatliche Subventionen für Autos – und wurde nicht erhört. Mussolini weigerte sich, den Traum Giovanni Agnellis zu verwirklichen, aus Fiat die zweiten Ford-Werke zu machen und aus Turin ein italienisches Detroit. Zwar fuhren auf den Straßen des faschistischen »Imperiums« zusehends mehr Autos, aber davon, ein echtes Massenprodukt zu werden, waren die Fiat-Wagen immer noch genauso weit entfernt wie Italien vom Rang einer führenden Industrienation.
1940 trat das Regime in den Krieg ein. Agnelli machte weiter Profit, obwohl die Pkw-Produktion drastisch zurückging. Aber der Absatz von Nutzfahrzeugen verfünffachte sich, und so konnte die familieneigene Finanzgesellschaft IFI fortwährend Immobilien in Florenz und Land in Umbrien kaufen: Das Vermögen sollte so geräuschlos und beständig wie möglich gesichert werden. Je länger der Krieg andauerte, je geringer die Erfolgsaussichten schienen, desto entschiedener ging der Unternehmer auf Distanz zu Mussolini. Im Januar 1943 listete die US-Botschaft in Bern einflussreiche Italiener auf, die die Zusammenarbeit mit den Alliierten suchten, und »Commendator« Agnelli aus Turin wurde an erster Stelle genannt – vor einem einflussreichen Grundbesitzer aus Kalabrien und einem Camorra-Boss aus Neapel. Tatsächlich verbot Agnelli nach Mussolinis Entlassung durch den König seinen Managern, in die Partei des faschistischen Satellitenstaates »Republik von Salò« einzutreten, den der entmachtete Duce unter Hitlers Protektion in Norditalien eingerichtet hatte und zu dem Turin ursprünglich gehörte. In Mirafiori wurde Vollbeschäftigung vorgetäuscht, um die Verschleppung der Arbeiter in deutsche Lager zu verhindern. Die Werksführung pflegte Kontakte zur Resistenza .
Wieder ging es um das Überleben der Fabrik, aber auch um das Fortkommen der Besitzerfamilie. Giovanni Agnelli hatte vom Faschismus in großem Stil profitiert. Die Löhne seiner Arbeiter waren von 1923 bis 1939 um 16 Prozent gefallen, seine Rendite war im selben Zeitraum ins Unendliche gestiegen. Als man ihn nach Kriegsende vor Gericht stellte, verstand der Patriarch die Welt nicht mehr. »Ich habe mein ganzes Leben der Arbeit gewidmet und denke nun, es könnte ein Fehler gewesen sein«, gestand er seinen engsten Mitarbeitern. Am 16. Dezember 1945 starb er als gebrochener Mann. Die von den Alliierten bombardierten Fiat-Werke lagen in Schutt und Asche. Und auch Juventus wartete auf den Wiederaufbau.
Gianni und Umberto
1947–2004
Von den sieben Geschwistern Agnelli übernahmen zwei Brüder die Juve, der Älteste, Gianni (1921–2003), und der Jüngste, Umberto (1934–2004). Der erste ein schillernder Charismatiker, der zweite ein zurückhaltender Pflichtmensch. Gianni und Umberto begleiteten den Klub sechs Jahrzehnte lang als Präsidenten oder Ehrenpräsidenten, vor allem aber stets als Besitzer und in ihren späteren Jahren schließlich auch wie Patriarchen. Der dritte Bruder Giorgio (1929–1965) litt an einer schweren Krankheit und starb früh, die Schwestern hielten sich vom Fußball fern – doch der Erste und der Letzte wurden die herausragenden Mäzene des Calcio in den Jahren des italienischen Wirtschaftswunders. Vorbilder und Konkurrenten für viele andere, kleinere »Feudalherren«, die sich ihre Klubs als teures Spielzeug leisteten, mit dem sie auf Kunden- und Wählerfang gingen. Solches kam den Gebrüdern Agnelli nicht in den Sinn. Sie hatten Juventus nicht gekauft, um damit höhere Ziele zu verfolgen, sondern waren als Erben mit dem Klub aufgewachsen. Er gehörte so selbstverständlich zu ihnen, dass sie gar nicht daran dachten, sich als Fußballbosse ins Rampenlicht zu drängen. Eher diente beiden die Erfahrung als junger Klublenker für spätere, wichtigere Aufgaben im Autokonzern.
Gianni Agnelli redete nicht über Fußball, wenn es um Geschäftliches ging. Er hielt das für unfein. Wenn ihn seine Gesprächspartner auf Juventus ansprachen, empfand er das als Anbiederei. »Man versucht da, eine Vertrautheit herzustellen, die nicht existiert.« Emblematisch aber ist die Episode um Michaíl Gorbatschow, der Turin besuchte, um Gespräche über Fiat und die Produktion in Russland zu führen. Da nahm ihn Gianni Agnelli am Morgen wie selbstverständlich mit zum Juventus-Training und fuhr wie immer selbst. Gorbatschow stieg also vor dem Trainingsgelände aus dem Auto und fragte vollkommen konsterniert den Dolmetscher: »Wissen Sie, was das soll? Was hat denn Agnelli hier auf einem Fußballplatz zu suchen?«
Anders war es mit den Arbeitern, da war Juventus die gemeinsame fidanzata , die Braut, von der beide Seiten träumten, der Fiat-Schlosser im Blaumann und der Industrielle im Kaschmirpullover. Juventus bescherte den Besitzern eine Popularität und eine »menschliche Komponente«, die sie als Industriebosse allein niemals erreicht hätten. Die Fußball-Leidenschaft schien Patron und Abhängige zeitweilig emotional auf eine Stufe zu stellen, litten und jubelten sie doch mit derselben Mannschaft. Für das Binnenklima war der Verein also wichtiger als für die Außenwirkung des Unternehmens.
Nach einem hauchdünnen Sieg seiner Juve beim AS Rom rammte der vom Spiel noch vollkommen benommene Gianni Agnelli einmal auf dem Parkplatz vor dem römischen Olympiastadion mit seinem Fiat 500 mehrere Autos. Die großzügig abgefundenen Geschädigten, allesamt Roma-Fans, zeigten Verständnis, war ihnen doch der damals mächtigste Mann Italiens als Mensch erschienen, geschwächt von jenen emotionalen Erschütterungen, die das spannende Fußballspiel, bei ihm genauso wie bei ihnen, ausgelöst hatte. Dass der Fußball alle gleich macht, ist natürlich eine Illusion, dass er das wirkungsvollste Identifikationspotenzial besitzt, war andererseits im Italien des 20. Jahrhunderts eine Tatsache. Und den Agnelli gelang noch etwas anderes. Sie übertrugen einen weit umspannenden Familiensinn etwa im Sinn einer altrömischen familia , zu der in der Antike auch die Leibeigenen gehörten, auf den Fußball. Sie »adoptierten« herausragende Spieler und vermittelten den Fans das Gefühl, ein Teil der wenn auch entfernteren Verwandtschaft zu sein. Vor allem Gianni Agnelli wollte als tifoso unter tifosi wahrgenommen werden, als »der einzige, der bezahlt«, wie er einmal betonte, aber deshalb noch lange nicht der Chef ist. Eher primus inter pares in einer Schicksalsgemeinschaft.
Читать дальше