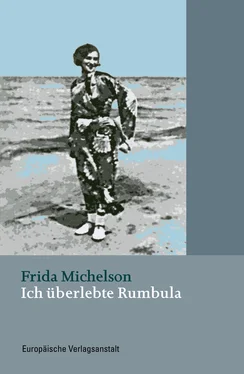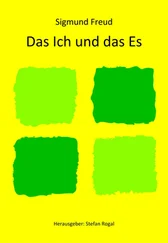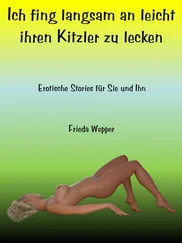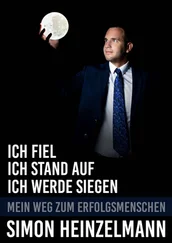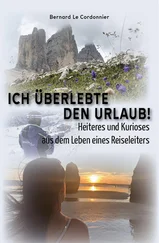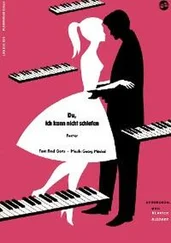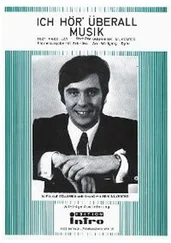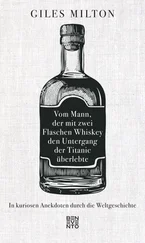Nach diesem Zwischenfall sprach es sich in der Gegend herum, dass auf den Feldern Jüdinnen aus der Stadt arbeiten. Da sie uns nicht einfach erschießen konnten, lauerten die örtlichen Speichellecker der Nazis auf Gelegenheiten, uns erniedrigen zu können. Rudelweise versammelten sie sich vor dem Stall, in dem wir übernachteten, schossen in die Luft, randalierten und grölten herum, als hätten sie den Verstand verloren. Das belastete unsere ohnehin schon angeschlagene Gesundheit und die angespannten Nerven noch zusätzlich.
In unserer Gruppe gab es eine Lehrerin, die alle Hoffnung aufgegeben und die Beherrschung verloren hatte, und die wieder und wieder sagte, dass man uns hier halb zu Tode schinden und danach abschlachten würde, und dass es besser sei, dem gleich selber ein Ende zu machen. Ich hielt dagegen und versuchte, die Übrigen zu beruhigen, insbesondere die Geschwächten, indem ich darauf hinwies, dass zurzeit die Arbeit unsere Rettung sei, sie helfe uns, über unsere unglückliche Lage hinwegzukommen, und dass wir nach Hause zurückkehren würden.
Die Lehrerin war beleidigt und redete nicht mehr mit mir, weil es mir gelungen war, die Frauen zu überzeugen. Auch mit einem achtzehnjährigen Mädchen aus Krāslava stritt ich mich; sie drückte sich systematisch vor der Arbeit und versteckte sich im hohen Gras, um zu schlafen. Das machte mich so zornig, wo doch unser greises Mütterchen jätete, ohne auch nur einmal aufzublicken. Alle waren über dieses Verhalten empört, aber niemand wollte sich mit ihr anlegen. Darum beschloss ich, ihre Taktik zu durchkreuzen, und bat den Aufseher, er möge jeder Einzelnen von uns einen bestimmten Abschnitt zu jäten zuweisen. Er war einverstanden. So war denn auch die junge Frau gezwungen, zu arbeiten wie alle anderen.
Inzwischen ging mir die Arbeit ganz gut von der Hand, ich jätete schnell und ordentlich. Nachdem ich mit dem eigenen Pensum fertig war, half ich dem Großmütterchen und auch dann hatte ich noch Zeit übrig. Denjenigen, die ihr Pensum erledigt hatten, erlaubte der Aufseher, zu einem Flüsschen hinunterzugehen, um uns und unsere Kleider zu waschen, die wir dann am Leibe trocknen ließen. So arbeiteten wir etwa sechs Wochen lang, bis wir sämtliche Rübenfelder der Umgebung fertig gejätet hatten.
Am Tag, an dem wir die Arbeit beendeten, teilte uns der Aufseher mit, dass eine neue Anordnung ergangen sei: Alle Juden müssten einen sechsstrahligen gelben Davidstern tragen, der gut sichtbar an der Kleidung angenäht ist.
Da wir keinen gelben Stoff hatten, befestigen wir Kartonsterne an unseren Kleidern. Als wir uns zum ersten Mal die gelben Brandmarkungen der „minderwertigen Rasse“ anstecken, brechen manche in Tränen aus, auch die Lehrerin fällt sofort über mich her:
„Ich hab’s doch gesagt, dass uns so oder so ein furchtbarer Tod erwartet. Wozu mussten wir uns für die noch abschuften, bevor wir eine Kugel in den Kopf bekommen?“
Der Aufseher bringt die Frauengruppe zum Fluss 12, wo ein kleiner Flussdampfer auf uns wartet.
„Ihr werdet schon sehen“, ereiferte die Lehrerin sich wieder, „sie bringen uns hin, wo es niemand sieht, und ersäufen uns!“ „Hört nicht auf sie, nur keine Panik, das wird nicht geschehen“, unterbreche ich die Lehrerin, „wir haben doch gut gearbeitet. Wir werden nach Hause zurückkehren.“
Nachdem er ein paar Worte mit dem Steuermann gewechselt hat, befiehlt uns der Aufseher, den Dampfer zu besteigen. Sobald wir uns alle hingesetzt haben, legt das Schiffchen ab.
„Wo werden wir hingebracht?“, fragen die zu Tode geängstigten Frauen eine nach der anderen den Aufseher.
Er weicht einer Antwort aus. Bedrückt sitzen wir da und ängstigen uns, dass jeden Augenblick etwas Schreckliches passieren kann. Aber das Schiffchen fährt und fährt, der Motor brummt monoton, bis schließlich in der Ferne die bekannten Türme von Riga auftauchen. In diesem Moment erfasst uns eine so große Freude, als ob es in dieser Stadt keine Nazis mehr geben würde. Der Dampfer legt an, der Aufseher sagt, dass wir nach Hause gehen können. Vor Glück fallen wir einander um den Hals, selbst die Lehrerin ist wie neugeboren – sie weint vor Freude, es scheint, als könne sie den Worten des Aufsehers immer noch nicht glauben. Herzlich verabschieden wir uns voneinander und gehen auseinander.
Ich gehe wieder zu meiner Wohnung – in der Hoffnung, meine Schwestern dort anzutreffen oder zumindest irgendein Zeichen oder einen Hinweis, aus denen sich schlussfolgern ließe, ob sie tatsächlich wegfahren und fliehen konnten. Mit diesen Gedanken erreiche ich meine Wohnung, doch an der Tür ist eine Bekanntmachung mit der Überschrift „Beschlagnahmt“ befestigt.
Heißt das, dass meine Wohnung und meine Habe jetzt den Deutschen gehören? Was tun? Ich nehme allen Mut zusammen und gehe auf die Präfektur. Dort wende ich mich forsch an den Diensthabenden mit der Armbinde. Ich erkläre ihm, dass ich heute aus Jelgava zurückgekommen sei, wo ich zusammen mit anderen Jüdinnen anderthalb Monate zur Zufriedenheit Feldarbeit verrichtet habe, und nun käme ich nicht in meine Wohnung, weil jemand sie beschlagnahmt habe. Ich wolle nur ein paar Habseligkeiten und Kleidung holen: einen Mantel, Kleider und Handtücher; alles andere – Gebrauchsgegenstände, Möbel und die Wohnung selbst – möge ihnen überlassen bleiben. Nachdem der Diensthabende mich sorgfältig gemustert hat, beginnt er in verschiedenen Büchern herumzublättern und vergleicht die Einträge. 13Schließlich sagt er:
„Ja, tatsächlich, es stimmt alles, Sie haben gut gearbeitet. Warten Sie einen Augenblick, ich werde Sie begleiten und nachsehen, was da los ist.“
Im Unterschied zu anderen Schutzleuten erscheint mir dieser Mann mit Armbinde menschlich. Er stellt sich sogar mit Namen vor und verhält sich höflich mir gegenüber.
Ich bringe ihn bis vor meine Wohnungstür. Nachdem er sich kurz die Bekanntmachung angesehen hat, drückt er sogleich entschlossen den Klingelknopf. Die Tür wird geöffnet, und auf der Schwelle steht eine junge lettische Dame von etwa dreißig Jahren – gekleidet in mein schwarzes Kostüm (das ich als Erinnerungsstück bis auf den heutigen Tag aufgehoben habe)!
„Guten Tag, meine Dame!“, beginnt der Polizist Svipste das Gespräch.
„Krisone“, stellt sich die junge Frau vor.
„Wer hat die Beschlagnahmung an der Tür angebracht?“
„Ich!“, antwortet die Krisone.
„Mit welcher Berechtigung?“
„Einige deutsche Offiziere, meine Freunde … Sie haben gesagt, dass ich hier wohnen kann. Übrigens, ich bin jetzt auch die Verwalterin dieses Hauses.“
„Gibt es einen Grund für die Großzügigkeit der deutschen Offiziere Ihnen gegenüber?“
„Nun, ich bin ihnen hier und da, sagen wir, ein bisschen gefällig.“
Auf dem Gesicht des Polizisten zeigt sich ein Grinsen.
„Sie haben gesetzeswidrig gehandelt, Frau Krisone, und sich eigenmächtig etwas angeeignet, was Ihnen nicht gehört. Können Sie denn eine Genehmigung vorweisen?“
„Nein.“
Ich nutze die peinliche Situation aus und mische mich in das Gespräch.
„Übrigens, das Kostüm, das sie trägt, gehört mir.“
Die Krisone errötet und wird verlegen wie ein aufgeschrecktes Vögelchen.
„Treten wir ein und schauen uns um!“, bittet Svipste mich in die Wohnung.
Die Krisone ist eine ziemlich schlechte Hausfrau. Noch nie war meine Wohnung derart verludert – leere Flaschen, benutzte Gläser, Geschirr mit Essensresten, Zigarettenstummel auf Sofa und Parkett … Offenbar hat hier nicht nur eine feucht-fröhliche Feier stattgefunden.
Sarahs Schlafzimmer ist mit Kleiderschachteln, Pelzen und Schuhen vollgestopft.
„Das sind nicht unsere Sachen“, erkläre ich dem Polizisten.
Die stammen wahrscheinlich aus anderen Wohnungen von Juden. In Svipstes Augen taucht ein Fünkchen Habgier auf. Für einen Augenblick sehen sich die beiden Kontrahenten an: Svipste voller Neid und Gier, die Krisone hingegen voll Angst und Hass.
Читать дальше