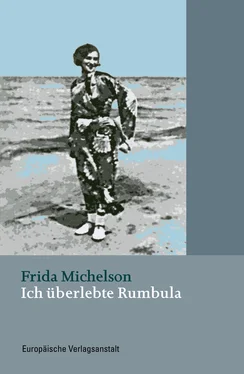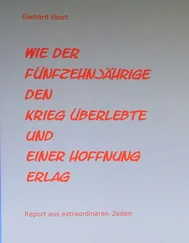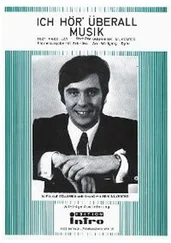Gleich in den ersten Tagen nach der Besetzung seien Hunderte von Juden zur Präfektur gebracht und gefoltert worden. Greise mit langen Bärten zwang man, Tallit und Tefillin anzulegen und sowjetische Lieder zu singen und dazu zu tanzen. Bei Weigerung drohte man ihnen mit Erschießung. Mädchen und junge Frauen wurden gezwungen, sich vor ihren Verwandten und Bekannten nackt auszuziehen und unzüchtige Geschlechtsakte zu vollziehen, viele wurden von den Selbstschutzleuten vergewaltigt. Durch das Erlittene verloren einige den Verstand.
Manche Opfer zwang man auch, in mörderischem Tempo unter Knüppelschlägen eine Treppe hinauf und hinunter zu rennen, bis sie, besonders Ältere und Kranke, tot zusammenbrachen.
Bestialisch gepeinigt wurden insbesondere diejenigen, die in die Folterkammern der lettischen Faschistenorganisation Pērkonkrusts in der Valdemāra iela 19 gerieten. Die Pērkonkrustler taten sich in besonderem Maße durch antisemitische Hetze hervor, sie waren die aktivsten Mörder bei den Massenvernichtungsaktionen und begingen als Erste Raubzüge in den Wohnungen ihrer Opfer.
Entsetzen packt mich, als ich von der unfassbaren Barbarei der Deutschen und ihrer Handlanger erfahre. Mir wird erzählt, dass vor einigen Tagen eine ganze Gruppe jüdischer Frauen nach der Arbeit auf einem offenen Feld lediglich deshalb erschossen wurde, weil sie „schlecht“ gearbeitet hätten.
Ob das vielleicht eine Falle ist? Vielleicht wurden wir hergebracht, damit sie morgen wieder jemanden zum Erschießen haben? Was soll ich tun? Ich beginne, eine Lücke zu suchen, durch die ich entkommen könnte, doch vergeblich, alle Türen sind verriegelt und bewacht.
Mehrere Stunden vergehen unter zermürbendem Warten. Dann wird die Tür geöffnet, ein Polizist tritt ein und verkündet: Zwölf Frauen werden zum Arbeiten aufs Land gebracht. Er beginnt mit der Selektion, und auch ich werde ausgewählt. Auch auf ein gebrechliches und gebeugtes Mütterchen fällt die Wahl. Die Angst steigt. Es heißt, dass die alten Leute gar nicht erst zur Arbeit gebracht werden, sondern gleich zu den Gruben.
Der Schutzmann 11befiehlt, uns in einer Kolonne aufzustellen. Wir werden über die Daugava zum Bahnhof Zasulauks gebracht. Ein Güterzug fährt ein. Uns wird befohlen, einzusteigen, und die Waggontüren werden verriegelt. Nach etwa einer Stunde hält der Zug, die Türen werden geöffnet, und wir müssen uns in Reih und Glied aufstellen. Wir sind von Polizisten umzingelt, unsere Namen werden auf irgendeiner Liste eingetragen. Das ist ein gutes Zeichen – also sind wir nicht zur Erschießung hergebracht worden.
Als ich mich umsehe, erkenne ich die Gegend, wir befinden uns in Jelgava, wo ich viele Bekannte hatte: Vielleicht entdecke ich ja ein bekanntes Gesicht. Doch in der Stadt sieht man nur ganz wenige Zivilisten, es kommen uns fast ausschließlich deutsche Soldaten und Polizisten entgegen. Dann sehe ich einen Konvoi von Einheimischen, offenbar festgenommene kommunistische Aktivisten. Sie wirken erschöpft und gequält, ihr Anblick ist mitleiderweckend.
Nach der Registrierung befiehlt ein Polizist, uns in Bewegung zu setzen. Übernächtigt schleppen wir uns die staubige Straße entlang. Einige Frauen sind schon völlig entkräftet. Hinter einem Wald geht prachtvoll die Sonne unter. Wohin wir marschieren, wissen wir nicht.
Nach einem Marsch von etwa zehn Kilometern gelangen wir endlich an einen Einsiedlerhof wohlhabender Bauern. Es ist bereits später Abend. Aus dem Haus kommt uns der Wirt entgegen, ein Lette in mittleren Jahren. Nachdem er mit dem Aufseher etwas besprochen hat, weist er uns einen Platz im Stall auf dem Heuboden an, wo wir übernachten sollen.
Erschöpft von dem langen Marsch und verängstigt von allem Erlebten, kriechen wir hinauf. Die meisten von uns haben seit über vierundzwanzig Stunden nichts gegessen, der Durst ist quälend, und wir haben Angst. Was erwartet uns?
Eine Lage Heu bedeckt den Boden. Es gibt nichts, womit man sich zudecken kann. Wir sammeln das Stroh zu einem Häufchen zusammen, lassen uns eng zusammengezwängt irgendwie darauf nieder und fallen vor enormer Erschöpfung bald alle in Schlaf. Noch vor Sonnenaufgang werden wir mit einem lauten Anschnauzer geweckt:
„Aufstehen, Zeit zum Arbeiten!“
Wir krabbeln hinunter, wo uns der Aufseher schon erwartet und zu einer Küche bringt. Endlich gibt man uns zu essen. Wir erfahren, dass wir ein Zuckerrübenfeld jäten müssen.
Das riesige Feld ist von Unkraut überwuchert, die Blätter der Rüben sind kaum noch zu erkennen. Der Boden ist lehmig und hart, es ist schwer, das Unkraut herauszuziehen. Für uns Städterinnen, die wir an solche Arbeit nicht gewöhnt sind, zu schwer und anstrengend. Bald haben alle blutige und schwielige Hände. Der Aufseher überprüft häufig, ob wir auch schnell genug arbeiten.
Jeden Tag teilt er uns ein bestimmtes Stück von dem Feld zu – das Pensum, welches wir zu schaffen haben – und schärft uns mit Nachdruck ein, dass wir, wenn wir schlecht arbeiten, erschossen werden. Uns ist klar, dass er seine Drohungen jederzeit wahr machen kann, und wir bemühen uns, alles zu seiner Zufriedenheit zu machen – wir arbeiten so gut wir können, wenn auch mit letzter Kraft. Als wir mit den Äckern des einen Bauern fertig sind, werden wir zu einem anderen Bauern gebracht. Die Arbeit ist dieselbe.
Unser Arbeitstag dauert von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Weder uns noch unsere einzigen verschwitzten Kleider, die wir am Leibe tragen, dürfen wir waschen. Schmutz und Schweiß haben sich in den Körper eingefressen, die Haut juckt, und es tauchen schon Läuse auf. Auch die Haare können wir uns nicht kämmen – weder haben wir einen Kamm, noch wird uns eine Arbeitspause gewährt. Zumindest werden wir verköstigt.
Manchmal sind die Nächte frostig. Dann drängen wir uns eng aneinander, doch auch das hilft nicht – es ist derart kalt, dass man nicht einschlafen kann. Die Schinderei und die unmenschlichen Verhältnisse, die glühende Sonne auf dem offenen Feld und die kalten Nächte bewirken das ihrige – wir sind entkräftet und Krankheiten breiten sich aus.
Unser altes Mütterchen wird auf dem Acker plötzlich ohnmächtig. Wir ziehen sie in den Schatten, legen sie ins Gras, verdecken sie, damit sie vom Aufseher nicht bemerkt wird, und versuchen, sie mit kaltem Wasser wieder zu sich zu bringen.
Am nächsten Tag bekommt ein junges Mädchen einen Sonnenstich. Sie hat unerträgliche Kopfschmerzen, muss sich ununterbrochen übergeben, und wir befürchten, dass sie stirbt. Es gelingt uns aber, den Aufseher zu überreden, dass er uns erlaubt, sie in den Schatten zu legen und ihr zu helfen – natürlich nur unter der Bedingung, dass wir übrigen Frauen das Pensum der Kranken übernehmen.
Einmal wurde auch mir beim Arbeiten schlecht und schwarz vor Augen, mir wurde schwindelig vor Schmerzen und ich bekam Nasenbluten. Ich drückte die Nase mit der Hand zu, brachte die Blutung mit einem in kaltes Wasser getauchten Lappen zum Stillstand, sammelte mich ein wenig und ging weiterjäten. Sich hinlegen oder ausruhen darf man nicht, dafür kann man mit dem Leben bezahlen. So ziehen sich die Tage dahin.
Einmal fährt ein fremder Aufseher auf dem Fahrrad an uns vorbei. Als er jüdische Frauen auf dem Feld arbeiten sieht, wird er hysterisch. „Wo kommen diese Jüdinnen her? Wer hat sie hergebracht? Wer ist der Verantwortliche?!“, poltert er und richtet die Waffe auf uns. „Ich!“, ruft unser Aufseher und eilt mit seinen Papieren auf ihn zu.
Nach einem scharfen Wortwechsel ist es „unserem Verteidiger“ gelungen, den Fremden zu überzeugen, dass er der bevollmächtige Aufseher dieser Gruppe Jüdinnen sei. Der zornige Radfahrer fährt unzufrieden weiter. Unsere Bäuerin sagte später: Wenn unser Aufseher nicht in der Nähe gewesen wäre oder seine von der Präfektur ausgestellte Vollmacht nicht hätte vorweisen können, dann wären wir alle wahrscheinlich auf der Stelle erschossen worden.
Читать дальше