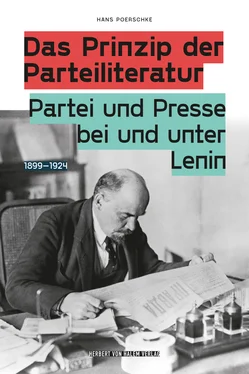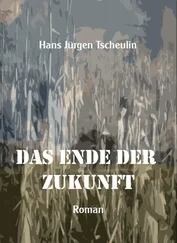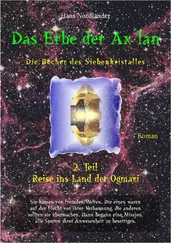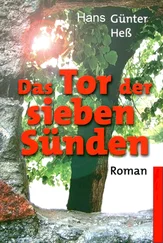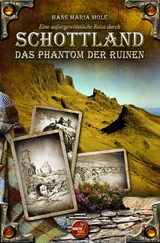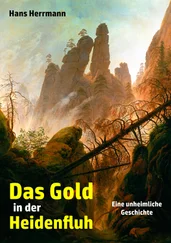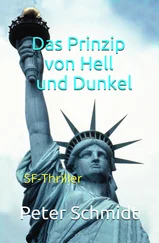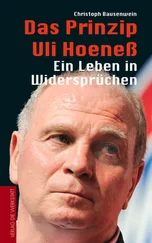iHANS POERSCHKE: Ich habe gesucht. In: MICHAEL MEYEN; THOMAS WIEDEMANN (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft . Köln: Herbert von Halem 2015. http://blexkom.halemverlag.de/hans-poerschke[5. Mai 2020].
iiVgl. HANS POERSCHKE: Sozialistischer Journalismus. Ein Abriss seiner theoretischen Grundlagen . Manuskript, mehrere Teile. Karl-Marx-Universität Leipzig: Sektion Journalistik 1988/89
iiiVgl. GÜNTHER RAGER: Journalisten brauchen Forschung und Statistik. In: MICHAEL MEYEN; THOMAS WIEDEMANN (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft . Köln: Herbert von Halem 2015. http://blexkom.halemverlag.de/rager-interview/[5. Mai 2020].
ivHANS POERSCHKE: Gedanken für die Gründungskommission, Mai 1991. In: Universitätsarchiv Leipzig , Sektion Journalistik 25, Bl. 71-75
vVgl. MICHAEL MEYEN: Abwicklung und Neustart. In: MICHAEL MEYEN; THOMAS WIEDEMANN (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft . Köln: Herbert von Halem 2020. http://blexkom.halemverlag.de/abwicklung/[5. Mai 2020]
viVgl. MICHAEL MEYEN: Von der Sozialistischen Journalistik zum Viel-Felder-Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. In: ERIK KOENEN (Hrsg.): Die Entdeckung der Kommunikationswissenschaft. 100 Jahre kommunikationswissenschaftliche Fachtradition in Leipzig: Von der Zeitungskunde zur Kommunikations- und Medienwissenschaft . Köln: Herbert von Halem 2016, S. 246-274
viiMICHAEL MEYEN: Leipzig nach der Wende: Michael Meyen: Landnahme, Verwestlichung oder Strukturwandel? In: MICHAEL MEYEN; THOMAS WIEDEMANN (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft . Köln: Herbert von Halem 2020. http://blexkom.halemverlag.de/landnahme/[5. Mai 2020]
viiiWOLFGANG RUGE: Lenin: Vorgänger Stalins . Berlin: Matthes & Seitz 2010
Jede soziale und politische Bewegung, die heute und künftig gegen die von der herrschenden Politik in den Ländern des Kapitals für sich reklamierte Alternativlosigkeit Alternativen zu bestehenden politischen, wirtschaftlichen, sozialen Strategien und Verhältnissen entwickeln, verbreiten und durchsetzen will, steht vor der Notwendigkeit, die vom herrschenden Mediensystem mit der veröffentlichten Meinung um alle ernsthaften alternativen Vorhaben errichtete Mauer zu durchbrechen, wenn sie in der Gesellschaft zu Gehör kommen, ja auch nur selbst eine bestimmte Größe überschreiten will.
In der Geschichte der politischen Parteien ist diese Lebensfrage über viele Jahrzehnte in Gestalt der Parteipresse beantwortet worden, einer Presse, die als publizistisches Organ einer Partei fungiert, auf deren Programm und politische Taktik verpflichtet ist, von ihr finanziert und kontrolliert wird, mehr oder weniger eng mit ihr organisatorisch verbunden ist. 1Die Bindung zwischen bürgerlicher Presse und Parteien war überwiegend relativ locker und historisch von kürzerer Dauer, da die privatwirtschaftliche Organisation der Presse flexiblere, massenwirksamere und dazu noch profitable Möglichkeiten zur Vertretung bürgerlicher Klasseninteressen bot. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war die Zeit der bürgerlichen Parteipresse abgelaufen. In der Arbeiterbewegung hingegen war die Bindung enger – die Anstrengung, eine eigene Presse materiell zu tragen, den Vertrieb zu bewältigen, Journalisten den Lebensunterhalt zu ermöglichen, war nur von einer Organisation mit opferbereiten Mitgliedern zu leisten. Zugleich entstand auch eine Abhängigkeit der Partei von ihrer Presse. Sie musste darauf bauen können, dass unter sich ständig verändernden Umständen sowie unter dem Druck einer an Kräften, Mitteln und Masseneinfluss überlegenen bürgerlichen Umwelt ihre Grundsätze in ihren Blättern konsequent vertreten wurden, dass sie also als eine unverwechselbare politische Kraft in der Öffentlichkeit wahrnehmbar war.
Unterschiedliche Interessen, Blickwinkel und Auffassungen wirkten unvermeidlich im Verhältnis von Partei und Presse als Widersprüche zwischen Ansprüchen von Leitungen und Parteibasis, Mehrheit und Minderheit, zwischen der für einheitliche Aktion erforderlichen Disziplin und der für die Entwicklung der Partei unerlässlichen Freiheit der Meinungsäußerung. Jeder größere innerparteiliche Konflikt erfasste auch das Verhältnis von Partei und Presse. Die alte deutsche Sozialdemokratie zum Beispiel wies eine ganze Geschichte solcher Konflikte auf, ob es sich um den Streit zwischen Reichstagsfraktion und Parteibasis um die Rolle des Züricher Sozialdemokrat anlässlich der sogenannten ›Dampfersubventionsaffäre‹ 1884/85 unter dem Sozialistengesetz handelte, um die Auseinandersetzung mit der Mitarbeit sozialdemokratischer Journalisten an der bürgerlichen Presse zur Zeit des Dresdener Parteitags 1903 und mit der ›Literatenrevolte‹ in der Vorwärts -Redaktion 1904/05 oder um die Konflikte zwischen Parteivorständen und regionalen Parteiorganisationen um die Verfügung über die Schwäbische Tagwacht 1914 und den Vorwärts 1916, bei denen es um die Haltung zum Krieg und das Verhalten in ihm ging. Nicht erstaunlich also, dass das Verhältnis von Partei und Presse bzw. Journalisten häufiger, wenn nicht ständiger Diskussionsgegenstand war, und dass von den Anfängen einer selbständigen Arbeiterbewegung an alle Schritte der Organisationsentwicklung auch Regelungen dieses Verhältnisses einschlossen.
Von einem Fall einer solchen Regelung soll im folgenden die Rede sein. Es handelt sich um Lenins Artikel Parteiorganisation und Parteiliteratur 2, in dem er das mit seinem Namen verbundene Prinzip der Parteiliteratur begründet hat, das in der Geschichte der kommunistischen Bewegung und des Staatssozialismus eine besondere Bedeutung gewinnen sollte. Lenin hat diesen Artikel wenige Tage nach seiner Rückkehr aus dem Exil, am 13. November 1905, in der legalen bolschewistischen Zeitung Nowaja Shisn , dem faktischen Zentralorgan der Partei, veröffentlicht. Die erste russische Revolution war seit mehr als einem halben Jahr im Gange und hatte mit Massenstreiks im Oktober 1905 einen Höhepunkt erreicht. Zar Nikolaus II. sah sich genötigt, auf die gesellschaftliche Umbruchsituation mit einem Manifest zu reagieren, das erstmals einige bürgerliche Freiheiten einräumte. Der Weg zur legalen Betätigung der Parteien – auch der Sozialisten – öffnete sich zeitweilig etwas. Lenin zögerte keinen Augenblick, eine der neuen Situation entsprechende Reorganisation der Partei und ihrer Publizistik in Angriff zu nehmen. Es ging ihm darum, Massenbasis und Massenwirkung der Partei durch die unter den Bedingungen der Illegalität nicht möglich gewesene Einbeziehung vieler sozialdemokratisch gesinnter Arbeiter in die Parteiorganisation zu erweitern, ohne den konspirativen Apparat der Berufsrevolutionäre aufzugeben. Und er sorgte sich darum, dass die Stimme der Partei im nunmehr offenen Parteienkampf deutlich und eindeutig zu vernehmen war. Dem dienten seine beiden für die Bolschewiki richtungweisenden Artikel Über die Reorganisation der Partei 3und Parteiorganisation und Parteiliteratur .
Den letzteren eröffnete er mit einer Charakterisierung der bisherigen Situation:
»Solange ein Unterschied zwischen illegaler und legaler Presse bestand, wurde die Frage, was als Partei- und was nicht als Parteiliteratur zu betrachten ist, äußerst einfach und äußerst falsch und unnatürlich gelöst. Die gesamte illegale Literatur war Parteiliteratur, wurde von Organisationen herausgegeben und von Gruppen geleitet, die so oder anders mit Gruppen praktischer Parteiarbeiter in Verbindung standen. Die gesamte legale Literatur war keine Parteiliteratur, weil die Parteien verboten waren – aber sie ›tendierte‹ zu der einen oder anderen Partei. Unnatürliche Bündnisse, anormale ›Ehen‹, falsche Aushängeschilder waren unvermeidlich.« 4
Читать дальше