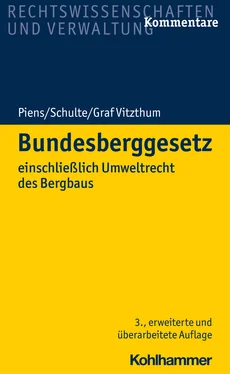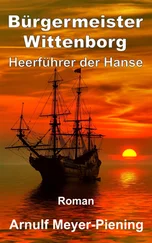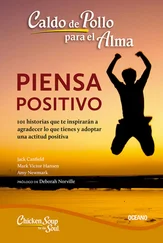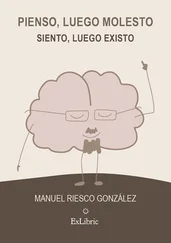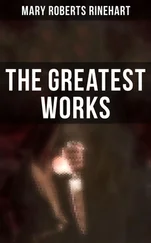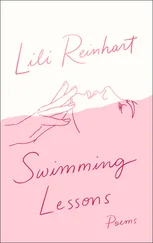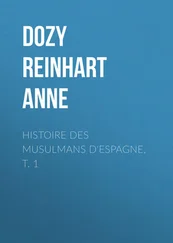18aAndere Anforderungen an den Rahmenbetriebsplan ergeben sich aus dem sog. Garzweiler-Urteil des BVerfG (BVerfGE 134, 242 = ZfB 2014, 49) in den Fällen, in denen für das Abbauvorhaben großflächig fremde Grundstücke in Anspruch genommen werdenmüssen. Die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes bedeutet dann bereits einen Eigentumseingriff und ist an Art. 14 GG zu messen. Daher ist bereits hier eine Gesamtabwägungzwischen den mit dem Vorhaben verfolgten Gemeinwohlzielen und den hierdurch beeinträchtigten privaten und öffentlichen Belangen erforderlich (BVerfGE 134, 242 Rn 159, 166, 188 ff. = ZfB 2014, 49, 69, 70, 73 ff. Frenz, NVwZ 2014, 194, 197; Degenhart, ZfB 2016, 145, 147; Dammert, ZfB 2014, 105, 111 f.). Denn diese Gesamtabwägung muss zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem effektiver Rechtsschutz noch möglich ist, d. h. im Rahmenbetriebsplan. Hier ist über die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens zu entscheiden einschl. darüber, ob die großflächige Inanspruchnahme von Grundflächen mit öffentlichen Interessen vereinbar ist. Auch steht mit der Entscheidung über den Rahmenbetriebsplan fest, dass das Vorhaben einer technisch und wirtschaftlich sachgemäßen Betriebsführung entspricht (Degenhart, a. a. O.).
18bDie Notwendigkeit der Gesamtabwägungergibt sich bei komplexen Vorhaben wie Braunkohlentagebauen aus der Eingriffswirkung der Zulassung des Rahmenbetriebsplans in das Eigentum. Sie unterscheidet sich im Rahmen der Zulassungsentscheidung nicht von derjenigen im Rahmen der Enteignungsentscheidung (BVerfGE 134, 242 = ZfB 2014, 49, 97; Dammert, ZfB 2014, 105, 112). Bei der Gesamtabwägung ist nach der gesetzlichen Bestimmung des Gemeinwohlzieles, der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des Vorhabens zu fragen (BVerfG a. a. O.; Dammert, a. a. O.). Die für das Vorhaben sprechenden Gemeinwohlbelange einerseits und alle durch seine Verwirklichung beeinträchtigten öffentlichen (Landesplanung, FFH-Gebietsschutz, EU-WRRL) und privaten (Betroffene gem. § 78 BBergG, d. h. Grundeigentümer, Pächter, Inhaber dinglicher Rechte u. a.) Belange andererseits sind gegeneinander abzuwägen. Die Zulassung muss auf der Grundlage der Gesamtabwägung vertretbar sein (BVerfG, a. a. O., Rn 282). Hinzu kommt die Prüfung der Versagungsgründe gem. § 55 Abs. 2. Dennoch bleibt die Betriebsplanzulassung eine gebundene Entscheidung. Daraus folgt, dass weder einer späteren Nachbesserung einer ursprünglich fehlerhaften Entscheidung durch eine später erfolgte Gesamtabwägung noch einer gerichtlichen Kontrolle als nachvollziehende Gesamtabwägungsentscheidung verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen (BVerfG a. a. O., Rn 322 = ZfB 2014, 449, 97; VG Cottbus, Urt. v. 25.10.2018 – 3 K 960/13 Rn 64; Dammert, a. a. O., S. 112).
18cNach der Rspr. des BVerfG führt nicht jede Drittbetroffenheit eines Eigentümers und nicht jede denkbare Enteignungsmaßnahme dazu, in gestuften Verfahren frühzeitig Rechtsschutz bereits im – obligatorischen oder fakultativen – Rahmenbetriebsplanverfahren zu gewähren und eine enteignungsspezifische Gesamtabwägung durchzuführen. Maßstab ist vielmehr das komplexe Großvorhaben(BVerfG, NVwZ 2014, 211 Rn 223). Nach den Vollzugsempfehlungen des Bund-Länder-Ausschusses Bergbau (Stand 13.11.2014) sind Indizien für ein komplexes Großvorhaben in diesem Sinne: mehrfach gestufte Genehmigungsverfahren, Rechtspflicht zur Durchführung eines UVP-Planfeststellungsverfahrens, Bergbauvorhaben mit großflächigen Auswirkungen auf das Oberflächeneigentum, lange Zeitachse von der Zulassung bis zur Grundstücksinanspruchnahme Dritter, Umsiedlung von Ortschaften oder zahlreichen Wohngrundstücken, Vielzahl von Betroffenen. „Das Vorhaben muss inhaltlich und zeitlich eine Dimension erreichen, die Korrekturen anlässlich eines Angriffs der Enteignungsentscheidung faktisch ausschließt“ (Bund-Länder-Ausschuss Bergbau, a. a. O., Ziff. II 1, BVerfG, a. a. O.).
18dBei der Erforderlichkeitist zu unterscheiden: Für das Vorhaben, d. h. den Bergbaubetrieb, ist ausreichend, dass es „vernünftigerweise geboten“ ist, zur Erreichung des Gemeinwohlzieles oder jedenfalls es substanziell zu fördern (BVerfG, a. a. O. Rn 228; Bund-Länder-Ausschuss Bergbau, a. a. O., Ziff. 3b). Die konkrete Enteignungsmaßnahme muss dagegen unverzichtbar für die Verwirklichung des Vorhabens sein.
18eDie Zulassung des Hauptbetriebsplanes ist nicht geeignet, die verfassungsrechtlich erforderliche Gesamtabwägung durchzuführen. Allein der Rahmenbetriebsplan hat die Zulassungsfähigkeit des Gesamtvorhabens im Blick oder zumindest größerer zeitlicher und räumlicher Abschnitte (Dammert, ZfB 2014, 105, 113; VG Cottbus, Urt. v. 21.12.2016 – 3 K 77.15 = ZfB 2017, 172, 176).
18fEine rechtmäßige Gesamtabwägung ist nicht Voraussetzungfür die Zulassungsfähigkeit des Haupt- oder Sonderbetriebsplanes. Daraus folgt, dass eine fehlende oder fehlerhafte Gesamtabwägung bei der Rahmenbetriebszulassung nicht die Zulassung eines Haupt- oder Sonderbetriebsplanes hindert oder rechtswidrig werden lässt (Dammert, ZfB 2014, 105, 114 f.). Auch kann durch die Zulassung eines Haupt- oder Sonderbetriebsplanes nicht die fehlende oder fehlerhafte Gesamtabwägung bei der Zulassung des Rahmenbetriebsplanes geheilt werden (Dammert, a. a. O.).
19Mit dem Gesetz zur Änderung des BBergG v. 12.2.1990 (BGBl, 215) wurde die Umweltverträglichkeitsprüfungin das Betriebsplanverfahren integriert. Die UVP wurde auf der Stufe des Rahmenbetriebsplans verankert, weil Umweltauswirkungen eines Vorhabens möglichst vorzeitig darzustellen und zu beurteilen sind. Wegen seiner Funktion, einen Überblick über das Vorhaben für einen längeren Zeitraum zu verschaffen, ist der Rahmenbetriebsplan für die UVP besonders geeignet (Himmelmann/Tünessen-Harmes, UPR 2002, 214; Ludwig, S. 48, Kühne, Leipziger Schriften, Band 15, 2009, S. 11, 13).
20In der Praxis werden im Braunkohlentagebergbauin NRW vor allem fakultative Rahmenbetriebspläne vorzulegen sein: nach Landesrecht ist die UVP-Prüfung auf der Ebene der Braunkohlenplanung durchzuführen (§§ 45, 14, 15 LPlG NRW, hierzu Kühne, Leipziger Schriften, Band 15, 2009, S. 11, 24). Auf der Stufe des Rahmenbetriebsplans findet eine UVP-Prüfung nicht mehr statt (§§ 52 Abs. 2b Satz 2 i. V. mit 54 Abs. 2 Satz 3). Anders ist die Rechtslage in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Braunkohlen- und Sanierungspläne (§ 4 UVPG – Brandenburg i. V. mit Anl. 2 Nr. 1.3.4 zu § 12 RegBkPlG) und die sächsischen Teilregional/bzw. Sanierungsrahmenpläne (§ 5 Abs. 1 LPG, § 3 Abs. 1a i. V. mit Anl. 2 Nr. 1c Sächs. UVPG) sind zwar SUP-pflichtig (Kühne, a. a. O.); das ersetzt aber nicht die UVP-Pflicht, die daher im obligatorischen Rahmenbetriebsplanverfahren abzuarbeiten ist, s. § 52 Rn 155 (so auch Boldt/Weller (2016), § 52 Rn 88).
21Seither unterscheidet das BBergG den einfachen ( fakultativen) Rahmenbetriebsplan und den qualifizierten ( obligatorischen) Rahmenbetriebsplan. Bei ersterem kann die zuständige Behörde die Aufstellung verlangen (§ 52 Abs. 2 Nr. 1), bei letzterem ist sie verpflichtet, die Aufstellung zu verlangen (§ 52 Abs. 2a).
22Rahmenbetriebspläne sind nach dem Wortlaut des Gesetzes auf Verlangen der zuständigen Behörde aufzustellen. § 52 regelt indes nur die Pflicht zur Aufstellung von Rahmenbetriebsplänen („[…] sind“). Das schließt nicht aus, dass der Unternehmer ohne Pflichtigkeit einen fakultativen Rahmenbetriebsplan vorlegt und die Bergbehörde hierüber zu entscheiden hat. Das ist inzwischen allgemeine Auffassung (Kühne, UPR 1986, 84; Boldt/Weller (2016), § 52 Rn 34; BVerwG, ZfB 1995, 285 = NVwZ 1996, 909; OVG Lüneburg, ZfB 1990, 24; VG Berlin, ZfB 1989, 132; Ludwig, S. 46). Zur Alternativlosigkeit des obligatorischen Rahmenbetriebsplanes s. § 52 Rn 127.
Читать дальше