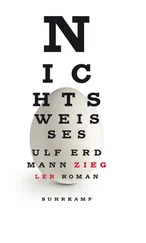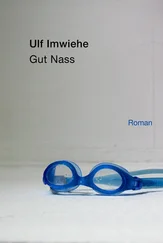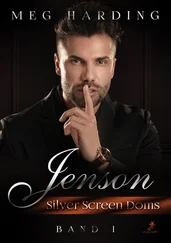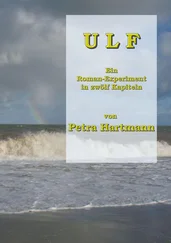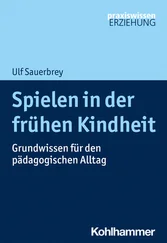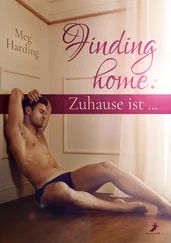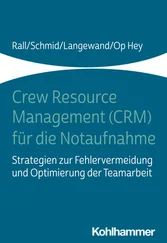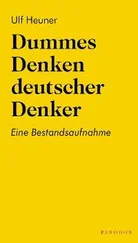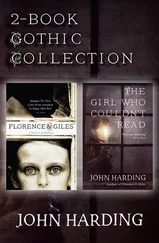Didaktische Begründung: Die Inhalte dieses Moduls stellen wichtige berufliche Grundlagen dar, die für die Arbeit in einer Notaufnahme unerlässlich sind. Die Teilnehmerinnen sind während dieser theoretischen Bearbeitung in einer zentralen Notaufnahme eingesetzt und schließen das Modul mit einer mündlichen Prüfung ab.
Noch vor Abschluss des 1. Weiterbildungsjahres beginnt das Fachmodul V.
Didaktische Begründung: Hier handelt es sich ebenfalls um Inhalte, die Grundlagen für die Arbeit in einer Notaufnahme vermitteln. Sie ergänzen damit die Themen des Fachmoduls I und sollten daher zu einem frühen Zeitpunkt abgehandelt werden. Die Teilnehmerinnen sind zu dieser Zeit in einer zentralen Notaufnahme eingesetzt. Das Fachmodul V schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab.
Das 2. Weiterbildungsjahr beginnt mit dem Fachmodul III.
Didaktische Begründung: Den Schwerpunkt bildet hier die Versorgung von Patientinnen mit internistisch-neurologischen Krankheitsbildern. Ein Fachgebiet, welches auf Intensivstationen in großem Umfang anzutreffen ist. Daher werden die Teilnehmerinnen in dieser Phase der Weiterbildung auf einer Intensivstation eingesetzt. Den Abschluss bildet eine schriftliche Modulprüfung.
Es folgt das Fachmodul IV.
Didaktische Begründung: Inhalte sind hier traumatologische Ereignisse mit und ohne Schockraumversorgung und Schmerzsymptome. Themen, die eine fachliche Nähe zur Anästhesie aufweisen. Daher absolvieren die Teilnehmerinnen zu dieser Zeit ihren Anästhesieeinsatz und schließen mit einer mündlichen Modulprüfung ab.
Den Abschluss bildet das Modul II, das mit dem Wahlpflichteinsatz gekoppelt ist.
Didaktische Begründung: Modulinhalte und Einsatzgebiete bilden spezielle Pflegesituationen ab, beziehen sich aufeinander und können im Fall des Einsatzes nach eigener Präferenz gewählt werden. Mit einer mündlichen Modulprüfung endet das Themengebiet und stellt gleichzeitig eine Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung dar.
Im Anschluss an den letzten Theorieblock werden die formalen Voraussetzungen zur Zulassung für die Abschlussprüfungen begutachtet. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erfolgen die Ladungen zu den Prüfungen spätestens drei Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin.
In den letzten zwei Monaten der Fachweiterbildung werden die Teilnehmerinnen wieder in den Notaufnahmebereichen eingesetzt, aus denen sie entsandt wurden. Dort findet auch die praktische Abschlussprüfung statt.
Die Weiterbildung endet mit der mündlichen Abschlussprüfung im letzten Weiterbildungsmonat.
Praktische Leistungsnachweise (PLN)
Der PLN 1 wird im ersten Semester im Bereich Notaufnahme erfüllt. Dies ist der originäre Arbeitsbereich der Teilnehmerinnen. Thematisch ist es den Teilnehmerinnen freigestellt, ob sie hier eine Patientin oder eine Gruppe von Patientinnen mit Angehörigen versorgen oder ein Praxisprojekt durchführen.
Der PLN 2 ist zu Beginn des zweiten Weiterbildungsjahres auf der Intensivstation zu absolvieren. Hier muss in jedem Fall die Notfallversorgung einer Patientin oder einer Patientengruppe ggf. mit Angehörigen nachgewiesen werden.
Der PLN 3 findet im letzten Semester vor den Abschlussprüfungen während des Wahlpflichteinsatzes statt. Hier können die Teilnehmerinnen wieder wählen, ob sie die Pflege von Notfallpatientinnen oder das Praxisprojekt durchführen möchten, falls dies noch nicht als PLN 1 geschehen ist.
Alle PLN dienen dem Theorie-Praxis-Transfer und zur Vorbereitung auf die praktische Abschlussprüfung. Sie werden von der Leitung der Fachweiterbildung, der hauptamtlichen Praxisanleiterin und anderen Fachkräften begleitet und bewertet.
Alle praktische Leistungsnachweise dienen dem Theorie-Praxis-Transfer und zur Vorbereitung auf die praktische Abschlussprüfung. Sie werden von der Leitung der Fachweiterbildung, der hauptamtlichen Praxisanleiterin und anderen Fachkräften begleitet, bewertet und mit einer medizinpädagogischen Lernberatung kombiniert. Letzteres hat sich aufgrund der Komplexität des Vorgangs als unpraktikabel erwiesen und wurde inzwischen insofern geändert, als dass die Lernberatungen nun in die Theorieblöcke integriert werden.
Praxisanleitungen
Tätigkeit der Praxisanleiterinnen
Im niedersächsischen Ministerialblatt vom 30.07.2018 wird die Praxisanleitung in den Schulen für Gesundheitsfachberufe und an Einrichtungen für die praktische Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz, Krankenpflegegesetz und dem Notfallsanitätergesetz beschrieben. Entsprechende Vorgaben sind aus unserer Sicht auf den Bereich Fachweiterbildung übertragbar.
Dort heißt es u. a.:
Die Schüler
 Erhalten individuell ein Erst-, Zwischen- und Auswertungsgespräch
Erhalten individuell ein Erst-, Zwischen- und Auswertungsgespräch
 Werden in allen übertragenen Aufgaben angeleitet und zu Kenntnisstand und Fähigkeit überprüft
Werden in allen übertragenen Aufgaben angeleitet und zu Kenntnisstand und Fähigkeit überprüft
 Erhalten die zur Erfüllung schulischer Praxisaufträge notwendige Unterstützung
Erhalten die zur Erfüllung schulischer Praxisaufträge notwendige Unterstützung
Die Praxisanleiter
 Sollen der Schule über den Entwicklungsstand der anvertrauten Schüler Auskunft geben und diese beurteilen
Sollen der Schule über den Entwicklungsstand der anvertrauten Schüler Auskunft geben und diese beurteilen
 Planen, dokumentieren und bewerten den Stand der praktischen Ausbildung
Planen, dokumentieren und bewerten den Stand der praktischen Ausbildung
 Wirken in enger Zusammenarbeit mit der Schule bei Planung und Gestaltung der praktischen Ausbildung in Form einer Praxisanleitung mit
Wirken in enger Zusammenarbeit mit der Schule bei Planung und Gestaltung der praktischen Ausbildung in Form einer Praxisanleitung mit
 Evaluieren regelmäßig das lernortspezifische Lernangebot
Evaluieren regelmäßig das lernortspezifische Lernangebot
 Prüfen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben in der praktischen Prüfung oder unterstützen den Prüfungsausschuss
Prüfen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben in der praktischen Prüfung oder unterstützen den Prüfungsausschuss
 Nehmen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil
Nehmen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil
(Vgl. RdErl. des Kultusministeriums vom 30.07.2018)
Die Praxisanleiterinnen sind darüber hinaus im Prüfungsausschuss vertreten. Sie sind nach DKG-Empfehlung als Fachprüferinnen für die praktische Abschlussprüfung einzusetzen.
Konkrete Organisation der Praxisanleitung an den praktischen Lernorten
Um die Vernetzung der Lernorte und den Theorie-Praxis-Transfer zu gewährleisten, ist die praktische Anleitung ein zentrales Instrument und somit ein wichtiger Bestandteil der Fachweiterbildung Notfallpflege. Im Nachfolgenden wird beschrieben, wie dieser Prozess in den klinischen Bereichen und der Lehrrettungswache organisiert wird und somit mindestens 10 % der praktischen Weiterbildung (180 Stunden) in Form von Praxisanleitung sichergestellt ist.
Die klinischen Anleitungen werden im Klinikum Braunschweig durch eine hauptamtliche Praxisanleiterin geplant, durchgeführt und dokumentiert. Die Anleitesituationen werden bereichsspezifisch – von den Theoriemodulen abgeleitet – erarbeitet und einzeln oder in Kleingruppen durchgeführt. Damit wird erreicht, dass die Teilnehmerinnen gegenseitig vom unterschiedlichen und interdisziplinären Erfahrungsschatz profitieren.
Читать дальше

 Erhalten individuell ein Erst-, Zwischen- und Auswertungsgespräch
Erhalten individuell ein Erst-, Zwischen- und Auswertungsgespräch