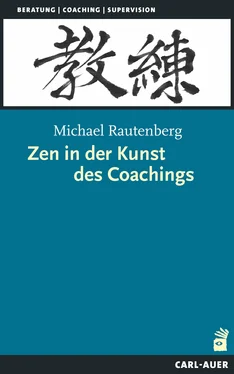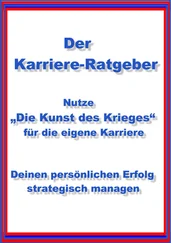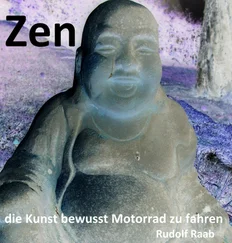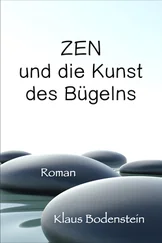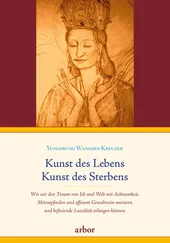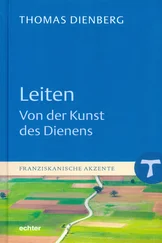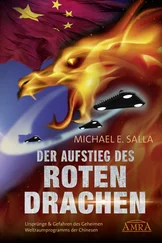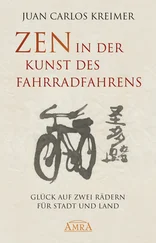Bevor es richtig losgeht, möchte ich aber noch einige Bemerkungen zum Coaching und zu den tieferen Zusammenhängen zwischen den erwähnten Denkrichtungen, Geistestraditionen und Theorien machen.
Coaching macht (nicht immer) Spaß
Zunächst einmal muss ich Folgendes aus tiefster Überzeugung festhalten. Nach meiner Erfahrung ist das Einzelcoaching die wundervollste Arbeitsform für alle, die sich berufen fühlen, Berater zu sein und schnell die Wirksamkeit des eigenen Beitrags spüren wollen. In diesem Setting kann man sich zu 100 % auf die Bedarfe des Klienten konzentrieren, die Auseinandersetzung zwischen Coach und Coachee ist häufig außerordentlich intensiv und spannend, es gibt keine Langeweile, weil immer Themen im Gespräch sind, bei denen der Klient voll dabei ist und, last, but not least: Wer an Menschen interessiert ist und ihnen gerne helfen möchte, wird sich immer wieder über besondere zwischenmenschliche Begegnungen freuen und auch die Dankbarkeit seiner Klienten genießen können. Das bedeutet aber nicht, dass Coaching Sessions stets harmonische Wohlgefühle erzeugen. Ganz im Gegenteil! Der langjährige Coach des Dallas Cowboys Football Teams, Tom Landry, hat mit seinem Coachingverständnis den Nagel definitorisch auf den Kopf getroffen:
»Ein Coach sagt einem Dinge, die man nicht hören möchte, und er führt einem vor Augen, was man nicht sehen möchte, sodass man zu dem werden kann, den man schon immer in sich erahnt hatte« (Schmidt et al. 2019, p. 86; Übers: M. R.). 7
Landry betont das Unbequeme und Fordernde am Coaching. Obwohl er ein Footballcoach war, ist seine Aussage meines Erachtens eins zu eins auf das Executive Coaching übertragbar. Wir müssen immer wieder unsere Klienten aus ihrer Komfortzone locken, damit sie sich im geschützten Raum erfahren, erleben und entwickeln können.
Man kann Coaching aber auch sehr viel nüchterner definieren als
»vertrauliche, prozessorientierte Beratung psychisch stabiler Menschen […], die unter Anwendung von Modellen und Interventionen psychotherapeutischer Herkunft in einem bestimmten Lebenskontext durch eine externe Person stattfindet« (Drath 2012, S. 16).
Diese Definition impliziert eine Grenzziehung zwischen Coaching und Therapie anhand der psychischen Stabilität, die den (Coaching-)Klienten auszeichnet und davor bewahrt, zum (Psychotherapie-)Patienten zu werden. Ob die Differenz zwischen »psychisch stabil« und »psychisch instabil« wirklich dazu taugt, den durchschnittlichen Managercoachee vom durchschnittlichen Therapiebedürftigen zu unterscheiden, lasse ich einmal dahingestellt sein. Zumindest spricht viel dafür, dass die Grenzen eher fließend sind. Wahrscheinlich ist gerade das der Grund, warum so viele Konzepte, Modelle und Vorgehensweisen aus dem therapeutischen Feld erfolgreich Eingang in die Praxis des Coachings gefunden haben. Wichtig in dieser Definition ist jedoch der Hinweis auf den prozessorientierten Charakter des Coachings. Für die Qualität des Beraters und seiner Beratung ist es eine notwendige Voraussetzung, dies zu akzeptieren und als grundlegendes Element seines Selbstverständnisses zu integrieren: In jeder Sitzung begibt man sich auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Das Bedeutsame zeigt sich von Moment zu Moment, und die Aufmerksamkeit des Coachs muss sich für das plötzlich aufscheinende Unerwartete, ja sogar das Unerwartbare bereithalten.
Einer der Wegbereiter und Berater der ersten Stunde in der deutschsprachigen Coachingszene, Wolfgang Looss, stellt in den Mittelpunkt seiner Definition, dass Coaching eine »personenbezogene Einzelberatung von Menschen in der Arbeitswelt« (Looss 1997, S. 13) ist. Mir gefällt diese glasklare Sicht sehr gut, steht sie doch einem verwässernden Trend unseres Metiers entgegen, der zahllose Derivate zweifelhaften Werts hervorgebracht hat: »Life-Coaching«, »Frauen-Coaching«, »Konflikt-Coaching«, »Projekt-Coaching«, »Weisheits-Coaching«, »Selbst-Coaching«, »Tele-Coaching«, »Medien-Coaching«, »Werte-Coaching«. Diese Explosion an Coachingformen, laut Looss »Bindestrich-Coachings« (ebd.), ist sicher dem Umstand geschuldet, dass auch in unserer Profession der eine oder andere Geschäftemacher unterwegs ist.
Bei aller Sympathie für die loosssche Definition möchte ich den Coachingbegriff aber doch ein wenig erweitern. Im Sport gibt es Coachs sowohl für einzelne Sportler, seien sie Individual- oder Mannschaftssportler, als auch für Mannschaften. In ganz unterschiedlichen Branchen, Organisationstypen und -formen habe ich seit den frühen 2000-Jahren die Erfahrung gemacht, dass man sich den Teams, insbesondere den Managementteams, widmen muss, um das Leistungspotenzial der jeweiligen Organisation zu erschließen. Ein wirklich gut funktionierendes Managementteam zählt zu den wichtigsten kritischen Erfolgsfaktoren jeder Organisation. Ein solches Team zu coachen zählt zu den vornehmsten Aufgaben in der Beratung. Gleichzeitig sieht es so aus, als würden hier bei den meisten Firmen riesige blinde Flecken angesiedelt sein. Die Analogie zu den Mannschaftssportarten mag abgegriffen sein – aber sie trifft tatsächlich mehr denn je zu. Starke Teams dienen als interner Prozessor für zunehmend komplexe Herausforderungen, auf die Unternehmen antwortfähig sein müssen. Im Teamcoaching kann es um innere Angelegenheiten des Teams (Dynamik, Kommunikation und Zusammenarbeit, Konfliktbearbeitung etc.) ebenso wie um Fragen gehen, die sich mit der Gestaltung der Teamumwelt befassen (Wie führen wir das Unternehmen? Welche Strategie schlagen wir ein? Welches Dienstleistungsportefeuille wollen wir anbieten? Wie wirken wir auf andere? …).
Im Coaching, ob als Einzel- oder als Teamberatung, entsteht ein sozialer Raum zwischen den beteiligten Personen. Schauen wir uns nun einmal etwas genauer an, wie dieser Raum, dieses System eigentlich zustande kommt.
»Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt« (Wilhelm Busch)
Wie entsteht das soziale System »Coaching«? Ist es selbstverständlich, wenn Berater und Klient zusammenkommen, dass dann, gegebenenfalls nach anwärmendem Small Talk, auch gleich das geschieht, was wir »Coaching« nennen dürfen? Wenn man ganz genau hinschaut, ist dieser Anfang, wie sprichwörtlich aller Anfang, schwer, und es wohnt ihm durchaus nicht immer ein Zauber inne. Für beide Beteiligten ist die Aufnahme eines Coachings voller Ungewissheiten. Niklas Luhmann nutzt den Begriff der »Kontingenz«, um zu erklären, wie soziale Systeme zustande kommen und erklärt ihn so:
»Der Begriff wird gewonnen durch Ausschließung von Notwendigkeit und Unmöglichkeit. Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist« (Luhmann 1984, S. 152).
Nichts ist notwendig, und nichts ist, wie Toyota viele Jahre in Werbespots hat verlauten lassen, unmöglich. Die einengende und bestimmende Wirkung von Notwendigkeiten und Unmöglichkeiten ist nicht gegeben, wenn etwas kontingent ist. Das ist eine wunderbare Beschreibung für die Situation, die wir im Coaching antreffen. Das Wesen des Coachings ist kontingent. Erwartungen des Beraters bezüglich des Verhaltens seines (potenziellen) Klienten mögen enttäuscht werden. So kann es geschehen, dass der Klient im ersten Treffen ein methodisches Grundsatzgespräch führen möchte, statt sich vorbehaltlos der beraterischen Kompetenz des Coachs anzuvertrauen. Oder er schwärmt ausführlich von einer früheren, unvergleichlichen Beratungserfahrung mit einem anderen Coach. Welcher Berater hat schon Lust, und sei es nur in der Erinnerung, im Schatten eines Kollegen zu stehen? Das fühlt sich ähnlich an, wie wenn der Ehepartner von einer verflossenen Liebe schwärmt. Umgekehrt kann es sein, dass der Berater sich aus der Sicht des Klienten nicht erwartungskonform verhält, indem er z. B. keinen Rat oder keinen Kaffee anbietet. Wenn solcherart Erwartungen unerfüllt bleiben, sie jedoch aus jeweils subjektiver Sicht die Voraussetzungen für das Angestrebte bilden, kann der Beginn einer Beratung ziemlich holprig werden. Wann und unter welchen Bedingungen beginnt das Coaching? Wie geschieht es, dass die Begrüßung, das Vorgeplänkel, der Small Talk oder die Konversation aufhört und das Beratungsgespräch beginnt? Jedes soziale System, so auch das Coaching, unterliegt nicht nur einer einfachen, sondern der doppelten Kontingenz. Darin ähnelt es dem Schachspiel: Ich bin am Zug und habe aus einer Fülle möglicher Optionen zu wählen, leider auch solcher, die sich als Fehler erweisen können. Dabei bin ich mir bewusst, dass mein Gegner, als Reaktion auf jede meiner Zugmöglichkeiten, wiederum aus einer Fülle von Optionen zu wählen hat, die sich ebenfalls als Fehler erweisen können. Während ich über meinen Zug nachdenke, denkt er darüber nach, wie ich möglicherweise entscheide und was er daraufhin unternimmt. Die Entscheidung für einen Zug, genauer: seine Ausführung, hebt diese Ungewissheit für einen klitzekleinen Moment auf, in der Systemtheorie sprechen wir hier von »Unsicherheitsabsorption«, wobei sofort wieder die Situation der doppelten Kontingenz entsteht. Das Spiel mit der Ungewissheit beginnt gewissermaßen von Neuem. Das ist unbequem und notwendig zugleich, denn was wäre eine Schachpartie, in der von vornherein feststünde, wer wann welchen Zug ausführt? Eine abgekartete Schachpartie ist gar keine echte oder eine bereits gespielte, allenfalls noch nachspielbare Schachpartie. Ohne die Analogie allzu sehr strapazieren zu wollen oder gar zu behaupten, das Coaching sei wie ein Schachspiel, kann man aber doch mit Fug und Recht behaupten, dass gerade die Ungewissheit das geschmackgebende Salz in der Suppe des Lebens allgemein und des Coachings im Besonderen ist. Kein gesunder Mensch möchte ein Leben führen, in dem er stets weiß, was als Nächstes geschehen wird, oder gar die »Ewig-grüßt-das-Murmeltier-Version« eines Lebens erfahren. In dem gleichnamigen Hollywoodfilm wird die Psyche des von Bill Murray dargestellten Protagonisten dadurch strapaziert, dass er jeden Tag ab dem Klingeln des Weckers immer das Gleiche erlebt. Sein Leben ist also durch ein Höchstmaß an Sicherheit und Gleichförmigkeit bestimmt bei gleichzeitig minimaler Ungewissheit. Die Ödnis vollkommener Vorhersehbarkeit lässt das Leben wenig lebenswert erscheinen. Gleichwohl sehnen sich die meisten nach mehr Gewissheit und streben auch danach. Dieses Bedürfnis wird auch unser Coaching beeinflussen. Die Nutzung von Tools, der Versuch, bekannte Muster wiederzuerkennen, Vor-Erfahrungen, die zu entsprechenden Vor-Urteilen führen, und Ähnliches dienen sämtlich dem Zweck, ein bisschen Gewissheit in den Beratungsprozess zu bringen. Mit Zen in der Kunst des Coachings möchte ich einer Haltung den Weg ebnen, die die prinzipielle Unvorhersehbarkeit jedes nächsten Augenblicks anerkennt, wertschätzt und nutzt. Das funktioniert am besten, wenn wir uns auf das Jetzt im Coaching einlassen. Der Vorteil dieser Haltung ist, dass sie unsere Arbeit besonders spannend macht.
Читать дальше