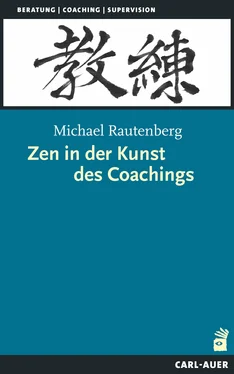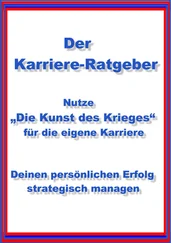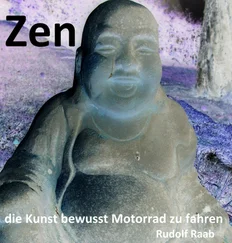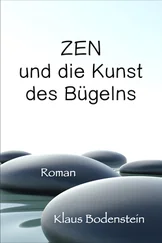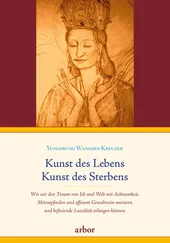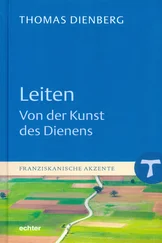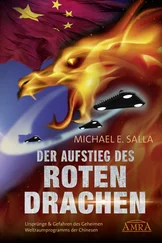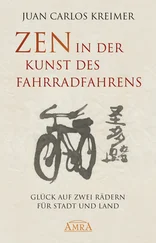Mit Zen in der Kunst des Coachings erfülle ich mir den seit einigen Jahren gehegten Wunsch, dem reichen Spektrum an Möglichkeiten, wie man Coaching auffasst und mit welcher Haltung man die Profession des Beraters ausübt, eine Facette ganz eigenen Charakters hinzuzufügen. Das Besondere an dieser Facette entsteht dadurch, dass ich die dialogische Philosophie mit der Systemtheorie neuerer Ausprägung und damit auch mit der Erkenntnistheorie des Konstruktivismus gedanklich zusammenführe und das Ganze zur Philosophie des Zen in Beziehung setze. Damit entsteht ein Ansatz, der nicht in erster Linie psychologisch bzw. psychotherapeutisch begründet ist. Denn das kann man wohl guten Gewissens über die etablierten Coachingkonzepte im Großen und Ganzen sagen: Sie wurzeln, sicher aus gutem Grund, in bewährten psychotherapeutischen Schulen. 1Tiefenpsychologische Ansätze haben zum Beispiel die Arbeit mit Glaubenssätzen inspiriert oder, durch C. G. Jungs Archetypenforschung, die Entwicklung von Persönlichkeitsmodellen und entsprechenden Verfahren, die im Coaching sehr beliebt sind, gefördert. Aus den humanistischen Psychotherapieformen stammen Modelle, wie zum Beispiel die lange Zeit sehr populäre Transaktionsanalyse oder Begleittechniken wie Rapport, Pacing und Leading. Die systemische Psychologie hat dafür gesorgt, dass zeitgemäße Kommunikations- und Erkenntnistheorien sich immer mehr durchsetzen konnten und darüber hinaus dem Coaching zahllose, inzwischen zum Allgemeingut gehörende Interventionen beschert, wie zum Beispiel das zirkuläre Fragen, die Appreciative Inquiry oder die Wunderfrage. Verhaltenspsychologische Ausrichtungen haben das Coaching sehr grundsätzlich mit ihrer pragmatischen Lösungsorientierung durch Klientenverhalten beeinflusst.
Konsequent zu Ende gedacht, mündet unser hier vertretener Ansatz in das Abenteuer des Loslassens um einer neuen Qualität des Sicheinlassens willen. Dabei geht es vor allem auch um das Loslassen von Tools und Konzepten zugunsten einer Haltung, die vom Geist des Zen und des Dialogs geprägt ist. 2Damit sollen die bestehenden und bewährten Coachingkonzepte nicht hinterfragt oder gar ersetzt werden. Die hier zusammengefassten Anregungen sind als – hoffentlich interessante – Ergänzung für die Praxis des Coachings im Besonderen, gegebenenfalls auch der Beratung allgemein, zu verstehen. Möglicherweise werden erfahrenere Coachs und Berater eher in der Lage sein, diese Anregungen zu nutzen. Wer über keine substanziellen Coachingerfahrungen verfügt, könnte sich in dem frei improvisierenden Wesen dieses Ansatzes unter Umständen leicht verloren fühlen. Die mir vorschwebenden Möglichkeiten lassen sich in jede seriöse Coachingpraxis integrieren und stehen ihr nicht entgegen. Sie sollen zum Ausprobieren einladen und Freude machen.
Unser Ansatz soll auch ein Ausdruck der Ehrlichkeit uns selbst gegenüber und in der Ausübung unseres Berufes sein. Die moderne Kommunikationstheorie gehört inzwischen zum Standard und damit auch die Erkenntnis, dass gelingende Kommunikation ganz und gar nicht trivial ist. Wie konsequent sind wir denn, diese Erkenntnis auch in unsere Praxis zu übertragen? Wie gut gelingt es uns, im Alltag nicht den verführerischen Mustern des konventionellen Sender-Empfänger-Modells mit seiner Metapher des Informationstransports zu folgen? Wenn wir es als Executive Coachs mit Managern zu tun haben, deren Betätigungs- und Wirkungsfeld eine Organisation ist, stellt sich die Frage nach unserem eigenen Organisationsverständnis. Was unterstellen wir denn in unserer Beratungsarbeit hinsichtlich Konstruktionslogik sowie Wirk- und Funktionsweisen von Organisationen? Es gibt zahlreiche mehr oder weniger plausible Organisationstheorien. Mit welcher oder welchen Theorien arbeiten wir, wenn wir als »Systemiker«, und das ist inzwischen auch Standard, den Kontext des Klienten in das Beratungsgeschehen einbeziehen? Wenn ich diese und andere Fragen aufrichtig beantworte, kommen viele sehr interessante Aspekte zum Vorschein. Besonders auffällig ist die Einsicht, dass unsere Möglichkeiten, beraterisch wirksam zu werden und Erfolge zu erzielen, zunächst einmal ziemlich begrenzt sind. Diese Einsicht nötigt mir Demut ab, eine Haltung, die ich nach vielem Nachdenken jedem Berater und Coach nur wärmstens empfehlen kann.
Im ersten , einführenden Teil des Buches gebe ich zunächst einen Überblick über einige der Quellen, aus denen ich seit vielen Jahren schöpfe und die deshalb eine wesentliche Grundlage für die Entstehung des vorliegenden Ansatzes bilden. In ihm widme ich mich dieser besonderen beratenden Form, die wir »Coaching« nennen. Vor allem liegt mir am Herzen, ihren von Ungewissheit geprägten Charakter aufzuzeigen. Denn daraus leitet sich für mich die bereits erwähnte Demutshaltung ab, die meiner Meinung nach eine beraterische Primärtugend sein sollte. Der zweite Teil dient der Darstellung der Zusammenhänge zwischen Zen und Systemtheorie. Aspekte wie die prinzipielle Nichtkontrollierbarkeit von Umwelt, das Zurückgeworfenwerden auf unser Selbst, die Unmöglichkeit der direkten Einwirkung auf andere, die Bedeutung der Unmittelbarkeit und des Jetzt, die Bedeutung von Unvoreingenommenheit und Verantwortung werden im Kontext des Beratungsgeschehens beleuchtet. Damit möchte ich deutlich machen, dass Systemtheorie und Konstruktivismus sehr gut mit der Philosophie des Zen vereinbar sind und dass wir als Berater aus dem Zen Haltung, Kraft und Inspiration gewinnen können. Im dritten Teil widme ich mich der vertieften Betrachtung von Beziehungsgestaltung und Dialog, weil sie einen Schwerpunkt für Haltung und Handeln des Beraters im Geiste des vorliegenden Ansatzes bilden. Mit einer konzentrierten Betrachtung zehn wesentlicher Konsequenzen aus den bisherigen Überlegungen schließe ich diesen Teil des Buches zusammenfassend ab. Im vierten Teil geht es dann um konkrete Ableitungen und Hinweise für die tägliche Coachingpraxis. Und abschließend biete ich einige Überlegungen an, die über das Feld der Beratung hinausgehen.
Das Buch enthält zahlreiche Fallbeispiele, die nicht dazu dienen sollen, meine beraterischen Heldengeschichten zu verbreiten. Vielmehr möchte ich mit ihnen einzelne Aspekte eines Coachings im Geiste des Dialogs und des Zen illustrieren und damit den Theorie-Praxis-Bezug veranschaulichen. Teilweise handelt es sich um Zufälle und teilweise sogar um Misserfolge. Aber allen Beispielen ist gemeinsam, dass ich aus ihnen lernen konnte und dass sie kleine Mosaiksteine im Gesamtbild des hier dargelegten Ansatzes sind. Ich hoffe, dass sie auch die tiefe, innere Freude vermitteln, die unser Beruf als Berater und Coach für uns bereithält. 3
1Einen gut strukturierten Überblick über die psychologischen und psychotherapeutischen Denkschulen, die das Coaching beeinflusst haben, bietet Drath (2012).
2Dirk Rohr kommt in seiner Beratungsforschung auch zu dem Schluss, »nicht eine Methode zu entwickeln und zu beschreiben, sondern ein Menschenbild, eine Philosophie und eine grundlegende Einstellung« (Rohr 2016, S. 69).
3Um der besseren Lesbarkeit willen wird in diesem Buch nur eine Form des grammatischen Geschlechts verwendet, diesenfalls (naheliegenderweise) die männliche. Aber es sind immer die weibliche Form und gegebenenfalls noch diverse Formen mitgemeint.
1Einführung
Wie peinlich! – Schopenhauer als Retter aus der Not
Karin E. 4, Geschäftsführerin einer Kommunikationsberatung, kam schon seit einigen Monaten zu mir ins Coaching. Sie war eine fachlich versierte, erfahrene Frau mit Charme, die ihr Handwerk verstand und ein gutes Auftreten hatte. Ihr Anliegen kreiste rund um die Frage, wie sie sich in der männerdominierten Topmanagementwelt ihrer Kundenunternehmen noch besser behaupten konnte. Allzu oft erfuhr sie trotz aller Wertschätzung für ihre Professionalität eine wenn auch subtile Herablassung durch ihre männlichen Klienten. Dann lief sie Gefahr, in die Rolle des kleinen Mädchens zu verfallen und nur noch in geringem Maße über ihre professionellen Ressourcen zu verfügen. In der Coachingsitzung, über die ich hier berichten möchte, geschah etwas sehr Unangenehmes. Ich hatte einen längeren Konzentrationsabriss. Etwa 20 Minuten, nachdem wir begonnen hatten, konnte ich mich nur noch daran erinnern, dass sie mir diesmal von zwei Ereignissen erzählen wollte, die kurz hintereinander stattgefunden hatten – eines war super gelaufen und das andere ziemlich schlecht. Davon abgesehen, hatte ich keine Erinnerung mehr, außer an den Small Talk zu Beginn der Sitzung. Sie war diesmal sehr aufgekratzt und redete praktisch ohne Punkt und Komma. Und ich hatte seit geraumer Zeit nichts, aber auch gar nichts mitbekommen. Ich hatte keine Ahnung, wie das geschah. Es war weder Langeweile, noch war es Desinteresse meinerseits. Ich war einfach irgendwie weggetreten. Welch eine peinliche Situation!
Читать дальше