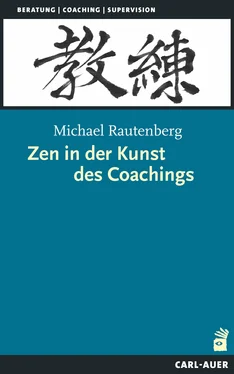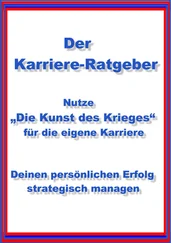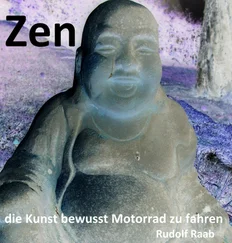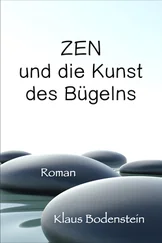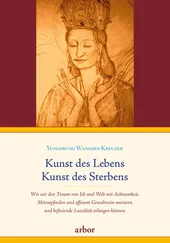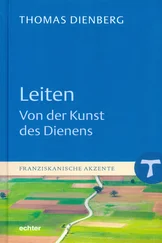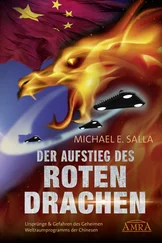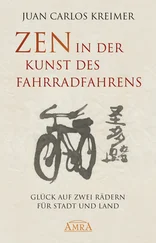Spiel ermöglichen, in Bewegung kommen und Beweglichkeit steigern
Lateral schauen
Der Stille Raum geben
Der Situation ihren Willen lassen
Dem Klienten einen gelegentlichen Stockschlag versetzen
Die Lösung sich ergeben lassen
Sprache bewusst und sorgsam gestalten
Schrittfolge des Vorgehens im »Zen-Coaching«
1. Schritt: Sich sammeln und logopsychosomatische Balance herstellen
2. Schritt: Den Klienten zu sich kommen lassen und Augenhöhe herstellen
3. Schritt: Tiefenkontakt herstellen und in den Dialog kommen
4. Schritt: Mit allen Sinnen breitbandig wahrnehmen und Lateralität praktizieren
5. Schritt: Der Situation ihren Willen und Interventionen geschehen lassen
6. Schritt: Wirkungen überprüfen und verankern
7. Schritt: Ausstieg und Abschied
Jetzt ist Schluss!
Literatur
Über den Autor
Es gibt wohl kaum ein deutlicheres Anzeichen für den fortgeschrittenen Reifegrad eines Handlungsfeldes oder Wissensgebietes als das Erscheinen von Büchern wie das vorliegende. Wenn Fachautoren sich in ihrer eigenen Praxis so weit entwickelt haben, dass Sie konzeptionelle Grenzen leichtfüßig überwinden, unangestrengt und elegant Metaperspektiven auf das professionelle Handeln entwickeln und damit im besten Sinne integrierend wirken, dann wissen wir: Die mit der Arbeitsform »Coaching« verbundene Innovation von einst ist längst im Praxisalltag angekommen. Und ungeachtet aller Einmaligkeit jedes Beratungsfalles: Wir haben als reflektierende Praktiker inzwischen in unseren Konzepten auch einige handwerkliche Routinen, sie ermöglichen die Weitergabe von ersten Kompetenzen und erleichtern den beraterischen Alltag. Und auch die Phase bausteinhaften Proklamierens immer neuer methodischer Varianten und Werkzeuge in der beraterischen Fachliteratur geht langsam dem Ende entgegen, jetzt offenbar auch im Arbeitsfeld Coaching. Die professionelle Praxis ist nicht nur erwachsen, sondern zeigt Anzeichen von Reife, sonst könnte ein solches Buch nicht geschrieben worden sein.
Dass ein Buch mit diesem Titel und ohne jedes esoterische G’schmäckle erscheint, das lässt doch hoffen: Nun können wir uns als arrivierte professional community qualitativ neuen Fragen unseres Handelns zuwenden. Fragen, die sich viel stärker um das Kontextuelle und die Rahmung drehen, weniger um lehrbare Praktiken des Intervenierens. Damit ist neue Relevanz in Sicht, der professionelle Blick wird deutlich ausgeweitet. So viel grundlegend Operatives ist inzwischen erarbeitet und vielfältig dargestellt, jetzt geht es eher um das Einordnen, Vergleichen, Abstimmen, um die Suche nach Entsprechungen und Kontrasten. Die Flughöhe unserer Beobachtung nimmt zu, wir sehen das Gelände und nicht mehr die Grashalme der Wiese. »Endlich!«, könnte man ausrufen.
Dabei dürfte dieses Buch bei Anfängern im Arbeitsfeld Coaching durchaus ambivalente Reaktionen hervorrufen, also seien sie schon mal etwas gewarnt: Hier schreibt ein Könner seines Faches. Es werden spielerisch und im schnellen Wechsel verschiedene Ebenen beraterischen Vorgehens angesprochen, der Verfasser jongliert gekonnt mit diversen konzeptionellen Zugängen und methodischen Mustern. Es wird also durchaus auch einiges vorausgesetzt, man lasse sich durch die illustrativen Beispiele und Fallvignetten nicht täuschen, inhaltlich wird hier Vollkornkost gereicht. Solche Opulenz muss nicht verschrecken. Wer sich selbst als professionell jung und lernend versteht, sich aber hinreichend intensiv für dieses faszinierende Arbeitsfeld mit dem – etwas unglücklichen – Namen »Coaching« interessiert, wird gerne und gelassen akzeptieren, bei der Lektüre gelegentlich auch überfordert zu sein. Nur Mut, den Ulysses von James Joyce liest man ja auch nicht mal eben so durch. Und vielleicht macht es Sinn, erst mal mit Einführungsliteratur einzusteigen, sie ist reichlich und erprobt vorhanden.
Wer hingegen schon einigermaßen in unserem beraterischen Zirkus zu Hause ist, wer seinen Luhmann und Buber etwas kennt, von Aurobindo und Pirsig schon mal was gehört hat, der wird beim Lesen sicherlich Freude haben. Spaß an gedanklichen Abenteuern beim Tanz durch Psychologie, Philosophie, Literatur und Transzendenz sei unterstellt. Auf erfahrene Praktikerinnen warten allerlei Aha-Erfahrungen, beglückende Einsichten im Sinne »einer Sicht« auf Verstreutes, auch wohl ein wiedererkennendes Lächeln bei den kleinen Fallgeschichten. Und am Ende keimt beim Lesen sogar die Hoffnung, dass aus all den Mühen beim ungewohnten Querschnittsblick irgendwann sogar eine handlungsleitende Theorie der Beratung hervorgehen könnte.
Selbstredend wünsche ich dem Buch eine breite Rezeption auch und gerade bei den arrivierten Praktikern unserer Professionswelt. Und dass es andere zu ähnlichen originellen Gesamtschauen ermutigen möge, damit unser fachlicher Diskurs wieder etwas saftiger wird. Die Ereignisse entlang der Corona-Krise zeigen, dass wir künftig substanzreiche Orientierungsproduktion werden betreiben müssen.
Wolfgang Looss Darmstadt, im März 2020
Kennen Sie den Film Twelve Angry Men (dt.: Die zwölf Geschworenen ) von Sidney Lumet? Falls nicht, bitte anschauen! Es ist ein brillantes, äußerst lehrreiches Kammerspiel aus dem Schwarz-Weiß-Kino der 1950er-Jahre. Der Plot ist schnell erzählt. Am Ende eines Gerichtsverfahrens versammeln sich die Geschworenen, um über Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu befinden. Die Jury besteht aus zwölf weißen Männern, die sich in den besten Jahren befinden. Der Angeklagte ist ein junger Puerto Ricaner und wird beschuldigt, seinen Vater mit einem Messer erstochen zu haben. Ein Schuldspruch müsste einstimmig erfolgen, denn im Falle eines Schuldspruchs droht dem Delinquenten der elektrische Stuhl. Der Film handelt fast ausschließlich von der nun beginnenden Verhandlung der Geschworenen. Kaum haben alle Geschworenen ihren Platz eingenommen, wird ohne große Beratung deutlich, dass sie sich einig zu sein scheinen. Und schon schlägt der Vorsitzende vor abzustimmen. Die schlichte Dramaturgie der Stimmzettelauszählung ist der erste Höhepunkt der Geschichte. Das Ergebnis lautet elf zu eins für »schuldig«. Und nun entwickelt sich eine Kommunikation unter den Jurymitgliedern, die allen Gruppendynamikern das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Der kollektive Druck führt schließlich dazu, dass der Abweichler sich outet und das Argument ins Feld führt, begründete Zweifel zu haben. Nun kann der Zuschauer beobachten, was es bedeutet, Zivilcourage zu praktizieren. Die Rolle des tapferen Zweiflers wird von Henry Fonda nach allen Regeln der Schauspielkunst ausgefüllt. Er drängt sich nicht in den Vordergrund und trägt seine Gedanken ruhig, ja beinahe demütig vor, indem er sie nicht im Gestus des Wissenden formuliert. Nach und nach gelingt es ihm, weitere Geschworene dazu zu bewegen, den Fall und seine Umstände zu explorieren. Eher Introvertierte trauen sich, eigene Gedanken zu artikulieren. Nun bekommen auch Ideen ihren Anwalt, die weitere Zweifel an der Schuld des Angeklagten entstehen lassen und vorher nicht kommuniziert wurden. Der Zuschauer erlebt, wie auch »Hardliner« immer weicher in ihrer Einschätzung werden. Es entsteht eine Atmosphäre, in der schließlich Selbstreflexion und Selbstoffenbarungen der Geschworenen deutlich machen, mit welchen Vorurteilen oder sonstigen Verständigungs-»Killern« sie ursprünglich in die Beratung gegangen waren.
Gruppendynamik und Tiefenpsychologie erzeugen die Spannung der Geschichte, aber es ist etwas anderes, das die subtile Bewegung der Geschworenenkommunikation in ein zunehmend konstruktives Miteinander bewirkt. Dieses Element tritt immer dann in Erscheinung, wenn in der Interaktion eine echte Zuwendung stattfindet, wenn davon ausgegangen wird, dass der andere recht haben könnte, wenn respektvoll auf Augenhöhe kommuniziert wird, wenn exploriert statt geurteilt wird, wenn aufmerksam zugehört wird, wenn Vorurteile ihren Tatsachenstatus verlieren und wenn selbstreflexive Selbstoffenbarungen in Erscheinung treten. Dies sind lauter Verhaltensweisen, die einen dialogischen Charakter haben. Sie haben in Twelve Angry Men bewirkt, dass aus einer regelrecht gewaltvollen Kommunikation ein Miteinander entstehen konnte, in welchem immer mehr so etwas wie ein Dialog stattfinden konnte. Eine Gruppe von weißen Männern, die in ihrer Rolle als Geschworene zusammengekommen waren, gehen am Ende des Films als Menschen auseinander, die sich nähergekommen sind, deren Bewusstsein sich verändert hat und die alle eine neue Perspektive auf ihr Leben gewonnen haben. Dadurch, dass die Geschworenen einen dialogischen Weg eingeschlagen haben, hat sich, fast nebenbei, mit dem Freispruch des jungen Puerto Ricaners ein gerechtes Urteil ergeben.
Читать дальше