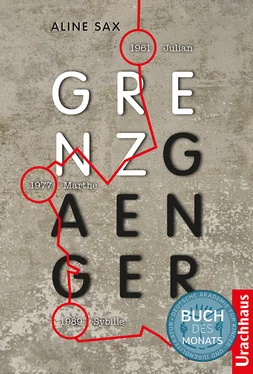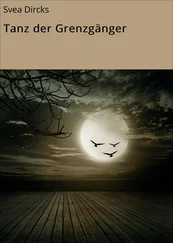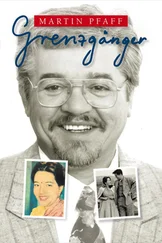Rolf ging in die Küche hinüber. Ich warf einen Blick auf den Wecker auf seinem Nachttisch. Viertel nach zwei. Mit einem Mal fühlte ich mich unendlich müde. Die Anspannung der letzten Stunden hatte alle Energie aus mir herausgesaugt. Und immer noch hörte ich die Schüsse, weit weg und gedämpft, wie durch einen Wattepfropf im Ohr.
Dann kam Rolf wieder ins Zimmer, eine Flasche Wodka und zwei kleine Gläser in den Händen. Er schenkte ein. Etwas sagte mir, ich sollte jetzt besser keinen Alkohol trinken, aber mit einem tüchtigen Schluck brachte ich die innere Stimme zum Verstummen.
Rolf setzte sich mit seinem Glas neben mich aufs Bett.
Ich wollte etwas sagen, aber mir schien jedes Wort überflüssig.
Ob ich geschlafen habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht richtig wach war, als das Morgenlicht durchs Fenster fiel und ich die leere Wodkaflasche auf dem Tisch sah. Ich war auch nicht richtig wach, als ich aus der Küche Geräusche hörte und es nach Kaffee roch. Richtig wach wurde ich erst, als Rolf sagte: »Musst du heute nicht deine neue Stelle antreten?«
Da sprang ich auf und stürzte in der Küche eine Tasse von dem Kaffee hinunter, den Alex aufgebrüht hatte.
Draußen schwang ich mich auf Rolfs Fahrrad und raste nach Hause, um meine Arbeitskleidung zu holen.
Verfluchter Mist! Der Tag hätte für mich nicht hier beginnen dürfen. Nicht auf dieser Seite der Mauer.
Das ganze Ausmaß der Misere begriff ich erst an der letzten Straßenecke vor unserem Haus. Denn dort ging mir schlagartig auf, dass die Stasi von unserem Fluchtversuch gewusst haben musste. Ich bremste abrupt.
Jemand hatte den Plan verraten! Doch wohl nicht Veronika? Wohin war sie überhaupt gelaufen? Hatten die Soldaten sie womöglich erwischt? Sie kannte meinen Namen und …
Ich spähte die Straße entlang, hielt Ausschau nach einem wartenden Auto, nach Männern vor unserer Haustür, die mich abpassen wollten.
Nichts dergleichen zu sehen.
Vielleicht waren sie oben in der Wohnung? Angestrengt blickte ich zu unseren Fenstern, ob da jemand hinter der Gardine stand. Der Gedanke, dass ich meine Eltern in Gefahr gebracht hatte, schnürte mir die Kehle zu. Aber mir blieb keine Wahl: Ich musste ins Haus.
Ich traf Mutter allein an. Vater war schon zur Arbeit gegangen und Franziska in die Schule. Alles war wie immer.
»Julian, du? Ich dachte, du hast heute deinen ersten Arbeitstag?«, sagte Mutter verwundert.
»Hab meine Arbeitskluft vergessen«, murmelte ich, ihrem Blick ausweichend, und hastete in mein Zimmer, um die Sachen zu holen.
Mutter wandte sich wieder ihrer Bügelwäsche zu. Gott sei Dank ahnte sie nicht, was in der Nacht passiert war. Besser gesagt, was nicht passiert war.
Ich verabschiedete mich mit einem Kuss, rief »Bis heute Abend!« und rannte die Treppe hinunter.
Wo die Baustelle war, auf der ich mich vor einer Stunde hätte melden sollen, wusste ich zum Glück auswendig.
Die nächsten Tage vergingen, ohne dass jemand von der Stasi bei uns zu Hause oder an meiner neuen Arbeitsstelle auftauchte. Nichts deutete darauf hin, dass ich beschattet wurde, und – soweit ich das mitbekam – horchte keiner meine Eltern oder Franziska über mich aus. Alles ging seinen gewohnten Gang. Bald hatte ich wieder das Gefühl, die Tage verliefen wie immer: Aufstehen, Arbeiten, Essen, Lesen, Schlafen, Aufstehen, Arbeiten, Essen, Kartenspielen, Schlafen, Aufstehen, Arbeiten … Erst wollte ich nicht zulassen, dass die eintönige Routine mich einlullte und jeden Gedanken an etwas anderes erstickte. Aber die Alltagsmaschinerie war mächtig, so mächtig, dass ich nicht dagegen ankam und bald anfing, wieder in den gewohnten Mustern zu denken, und mein Leben als normal empfand.
An einem Mittwochabend ging ich mit meinen Eltern in das ehemalige Gemeindehaus unseres Viertels, wo Franziskas FDJ-Gruppe ihre monatlichen Zusammenkünfte hatte. Diesmal sollte Franziska von ihrem Ernteeinsatz berichten, und das wollte Mutter auf keinen Fall verpassen. Vater und ich begleiteten sie, ich ziemlich widerwillig, er vermutlich genauso ungern. Ich hatte keine Lust, mir stundenlang politisches Gerede und Kampflieder anzuhören, aber Mutter bestand darauf, dass wir zu dritt hingingen. »Wir müssen Franziska zeigen, dass es uns interessiert, was sie so macht. Vor allem du, Julian, tätest gut daran, sie etwas mehr zu unterstützen, zu dir als großem Bruder schaut sie auf. Als sie vom Ernteeinsatz zurückkam, hast du kaum zugehört, was sie erzählt hat.«
Ich hatte die Augenbrauen hochgezogen und etwas erwidern wollen, aber da hatte Mutter sich schon weggedreht. Ich war mir sicher, dass es nur einen Grund gab, weshalb Franziska sich über mein Kommen freuen würde: weil sie genau wusste, dass mir dieser ganze FDJ-Zirkus auf die Nerven ging und ich nur gezwungenermaßen da war.
Im Saal war es nicht sonderlich voll, aber trotzdem warm und stickig. Vorn war ein kleines Podium aufgebaut, und an der Wand dahinter hing ein großes blaues Tuch mit gelb bemalten Buchstaben aus Styropor: Das Vaterland ruft! Schützt die Republik! Zu beiden Seiten prangte die blaue FDJ-Fahne mit dem gelben Emblem der aufgehenden Sonne. Auf dem Podium selbst standen drei Stühle und ein Rednerpult. Daneben eine niedrige Turnbank und davor optimistisch viele Stühle. Die ersten zwei Reihen waren bereits von FDJlern belegt, alle piekfein in Uniform. Vater setzte sich in die vorletzte Reihe, und ich nahm neben ihm Platz. Ich sah Mutter an, dass sie lieber weiter vorn gesessen hätte, aber um des lieben Friedens willen schwieg sie. Außer uns waren noch einige weitere Erwachsene da – Eltern vermutlich, und eine Handvoll Lehrer, die aber längst nicht alle vorhandenen Plätze füllten. Der Saal würde wohl zur Hälfte leer bleiben. Die Tür rechts neben dem blauen Tuch stand einen Spalt offen. Hin und wieder spähte ein Mädchen hindurch, sichtlich aufgeregt. Hoffentlich kam Franziska fast um vor Nervosität …
Das Programm begann um Punkt acht. Eine Gruppe Mädchen kam herein. Sie trippelten zur Turnbank und bildeten Reihen, eine darauf und eine davor. Zwei Männer in Anzügen mit gut sichtbarem Hammer-und-Zirkel-Anstecker am Revers und Ledermappen unterm Arm nahmen auf dem Podium Platz.
Die junge FDJ-Leiterin trat ans Rednerpult: »Ich entbiete euch den Gruß der Freien Deutschen Jugend: Freundschaft!«, rief sie in den Saal. Die FDJler in den ersten Reihen sprangen auf und riefen ebenfalls »Freundschaft!«
Nach dieser Begrüßung fuhr die Leiterin fort: »Vor Kurzem hat die Partei uns, der Freien Deutschen Jugend, einen Kampfauftrag erteilt. Einen Auftrag, für den Frieden einzutreten und die Grenzen unseres Landes zu sichern. Aufzustehen gegen die faschistischen Kriegstreiber und die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus. Jetzt ist es an uns, alle Kräfte zu bündeln! Das Wohl der Arbeiterklasse ruht auf unseren Schultern! Vierundzwanzig Mitglieder unserer Einheit verstärken inzwischen die Grenztruppen. Sie versehen ihren Dienst hier, in Berlin, am antifaschistischen Schutzwall, der unsere Republik vor dem verderblichen Einfluss des Kapitalismus schützt. Sie gehören nun zu den bewaffneten Kräften der Deutschen Demokratischen Republik und damit zu den unbesiegbaren Streitkräften des sozialistischen Lagers, an deren Spitze die stärkste Armee der Welt, die ruhmreiche Armee der Sowjetunion, steht. Diese Streitkräfte werden jedem imperialistischen Aggressor, der versuchen sollte, die Deutsche Demokratische Republik anzutasten, einen tödlichen Schlag versetzen!« Sie sprach, als stünde sie vor einem ganzen Stadion voller Zuhörer. Ihre Augen leuchteten, und ihre Stimme klang laut und sicher. »Aber auch an anderen Fronten tragen wir das Unsere bei. Der Ernteeinsatz, an dem fünf aus unseren Reihen teilgenommen haben …«
Читать дальше