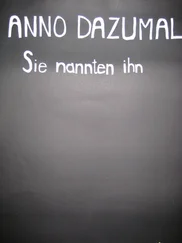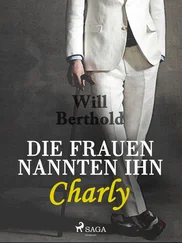Ich war aus meiner Unbemerktheit gefallen, aus meinem Gehäuse. Aber das stimmt so nicht. Sein Blick und die Anerkennung, die mir daraus entgegengeleuchtet war, hatten lediglich den Raum um mich herum ein wenig gelichtet. Morgens nickte er mir zu. Ich nickte zurück. Abends hob er die Hand, wenn er ging. Ich hob die meine. Ein stummes Einverständnis. Du bist da. Ich bin da. Wir haben beide das Recht, einfach nur da zu sein.
Was sich zwischen uns verändert hatte, war bloß eines. Ich ahnte es. Dass ich jetzt, da er mich bemerkt hatte, ein Bild in ihm geworden war. Er hatte jetzt eine Vorstellung von mir, und seine tägliche Begrüßung galt dem Bild, das er sich von mir gemacht hatte. Er besah es sich. Ruhig. Sein Schauen war nicht aufdringlich. Ich wurde aufgenommen in seine Erinnerungen. Er erinnerte sich an einen Tag am Meer, feinkörniger Sand, struppiges Dünengras, er erinnerte sich an den Bart seines Vaters, harte Stoppel am Kinn, an ein bestimmtes Licht, wie es an einem Morgen im Spätherbst über den Rücken seiner Frau hinfiel, an ein Lächeln im Schaufenster, zufällig, das warme Fell einer Katze, die sich an ihn schmiegte. Er hatte tausend Erinnerungen, tausend Bilder, und ich war jetzt, da er mich bemerkt hatte, eines davon.
Ich ließ es zu. Ich bot ihm mein Profil, hielt still, damit er es in sich aufnehmen konnte. Schaute selbst auch zu ihm hin. Nahm ihn weiter in mich auf. So wurde aus unserer minimalsten Bekanntschaft eine minimale Freundschaft.
Miteinander zu sprechen wäre zu diesem Zeitpunkt noch eine Übertretung gewesen. Da war eine Grenze, der Kiesweg. Hier meine, dort seine Bank. Dazwischen Grashalme, ein rollender Ball, ein Kind, das hinterherpurzelte.
Zwei Jahre lang hatte ich mich darin geübt, das Sprechen zu verlernen. Zugegeben, es war mir nicht gelungen. Die Sprache, die ich gelernt hatte, durchdrang mich, und sogar, wenn ich schwieg, war mein Schweigen beredt. Ich sprach innere Monologe, sprach unentwegt in die Sprachlosigkeit hinein. Der Klang meiner Stimme jedoch hatte sich in mir verfremdet. Nachts wachte ich zuweilen schweißgebadet aus einem Albtraum auf, nur um ihn fortgesetzt zu finden in dem rohen Aaah, das aus meinem Bauch, meinen Lungen, meiner Kehle drang. Wer ist das, der da schreit, fragte ich mich und schlief wieder ein. Wanderte durch eine Landschaft, in der jeder Laut im Moment seines Entstehens verhallte. Der letzte Satz, den ich ausgesprochen hatte, war gewesen: Ich kann nicht mehr. Punkt. Ein vibrierender Punkt. Danach war etwas zugeschnappt. Die Anstrengung, die es kosten würde, dort weiterzusprechen, wo ich aufgehört hatte, stand gegen die Sinnlosigkeit, in Worte zu fassen, was sich nicht ausdrücken ließ.
Mein Zimmer glich nach wie vor einer Höhle. Hier war ich groß geworden. Hier hatte ich im eigentlichsten Sinne meine Unschuld verloren. Ich meine, groß zu werden bedeutet einen Verlust. Man glaubt zu gewinnen. In Wahrheit verliert man sich. Ich trauerte um das Kind, das ich einmal gewesen war und das ich in raren Momenten in meinem Herzen wild um sich schlagen hörte. Mit dreizehn war es zu spät gewesen. Mit vierzehn. Mit fünfzehn. Die Pubertät ein Kampf, an dessen Ende ich mich verloren hatte. Ich hasste mein Antlitz im Spiegel, das Sprießende, Treibende darin. Die Narben an meiner Hand stammen alle von dem Versuch, es wiedergutzumachen. Unzählige Spiegel, zerschlagen. Ich wollte kein Mann sein, der glaubt, er gewinnt. In keinen Anzug hineinwachsen. Kein Vater sein, der seinem Sohn sagt: Man muss funktionieren. Vaters Stimme. Mechanisch. Er funktionierte. Wenn ich ihn ansah, sah ich eine Zukunft, in der ich langsam, zu langsam ums Leben kommen würde. Nichts funktioniert, hatte ich zurückgegeben. Und dann: Ich kann nicht mehr. Dieser letzte Satz war mein Leitspruch. Das Motto, das mich überschrieb.
Derart überschrieben saß ich auf meiner Bank, als er wieder einmal, Punkt neun, plötzlich aufgetaucht war. Es war ein Donnerstag, ich erinnere mich: Er kam, gebeugt wie unter einer schweren Last. Ich bildete mir ein, er sei über Nacht gealtert. Die Falten an seinem Hals, als er mir zunickte. Da bist du ja. Ich nickte zurück. Und mehr noch als das: Ich nickte eine Einladung. Mir selber unbegreiflich, nickte ich ihm, der gealtert war, zu und nickte selbst dann noch, als er mir entgegenkam, zögernd, über die Grenze hinweg, und mir eine Zigarette anbot.
Ōhara Tetsu. Er verbeugte sich leicht. Hajimemashite.* Du rauchst nicht? Ist gut. Fang besser gar nicht damit an. Es ist eine Abhängigkeit. Siehst du, ich brauche das. Er setzte sich neben mich, zwischen uns seine Aktentasche. Das Klicken des Feuerzeugs, er paffte. Eins dieser Dinge, sagte er, die ich nicht lassen kann. Wieder nickte ich. Ich habe alles probiert. Umsonst. Ich komme nicht los davon. Mir fehlt der Wille. Sicher kennst du das. Belegte Stimme, er hüstelte. In der Firma, sagte er weiter, rauchen alle. Es ist der Stress, der nie aufhört. In der Firma. Er bückte sich, drückte die Zigarette aus. Den Rest des Morgens verbrachten wir schweigend auf unserer Bank. Mit einem Nicken war sie zu unserer geworden.
Hin und wieder kam jemand vorbei. Eine Mutter, die einen Kinderwagen schob. Ein hinkender Mann. Ein Grüppchen Schulschwänzer in zerknitterten Uniformen. Die Erde drehte sich. Auffliegende Vögel. Ein Schmetterling, der sich für Sekunden auf der Bank gegenüber niederließ. Nebeneinander sitzend, schauten wir ihm nach, wie er davonschwebte. Leise Ahnung, dass es von nun an kein Zurück mehr gäbe.
Von Kyōko, sagte er, als er zu Mittag sein Bentō auspackte. Karaage* mit Kartoffelsalat. Von meiner Frau. Sie ist eine wunderbare Köchin. Magst du? Nein? Er lächelte verlegen. Du musst wissen, sie steht jeden Morgen um sechs Uhr auf, um mir mein Bentō zuzubereiten. Dreiunddreißig Jahre lang. Jeden Morgen um sechs. Und das Beste daran: Es schmeckt! Er rieb sich den Bauch. Fast zu gut, stockend, für einen wie mich. Aber, nicht wahr, ich habe Glück! Mit diesen Worten wandte er sich seinem Essen zu.
Vor meinem inneren Auge sah ich Kyōko, seine Frau, im Nachthemd in der Küche stehen. Zischendes Öl. Ein Klecks Marinade an ihrem Ärmel. Sie hackt und rührt. Schält. Schneidet. Salzt. Das ganze Haus ist erfüllt von den Geräuschen des Hackens und Rührens. Des Schälens. Schneidens. Salzens. Er wacht auf. Noch halb im Schlaf, denkt er: Ich habe Glück. Er denkt es mit einer in ihrer Unermesslichkeit kaum erträglichen Traurigkeit: Ich habe verdammt großes Glück. Er steht auf. Geht ins Badezimmer. Beugt sich über das Waschbecken und dreht kaltes, sehr kaltes Wasser auf. Hält das Gesicht hinein, die Haare, den Nacken. Dreht weiter. Taucht auf. Und wieder unter. Bleibt untergetaucht. Dreht zu. Bleibt unten. Hört das Glucksen im Abfluss. Dreht auf. Zu. Auf. Zu. Sieht, wie das Wasser sich in Tropfen, die Tropfen sich in Tröpfchen teilen. Ein Klecks Zahnpasta am Beckenrand. Weiß auf Weiß. Er greift mit dem Finger hinein und –
– Kyōko weiß es nicht. Ein leichtes Aufstoßen. Er sprach wie zu sich selbst: Kyōko weiß nicht, dass ich hierher komme. Ich habe es ihr nicht gesagt. Gedehnte Silben: Ich ha-be ihr nicht ge-sagt, dass ich mei-ne Ar-beit ver-lo-ren ha-be.
Die Pause danach. Ich war zum Mitwisser geworden. Eben erst ausgesprochen, hatte uns sein Geheimnis zu Verbündeten gemacht. Es war das Gewicht in meinen Füßen, die Unmöglichkeit, endgültig, auf und davonzugehen. Er hatte sich mir anvertraut, allein mir. Ich schaute auf die Schuhe, die mich drückten. Ausgebeult und abgegangen. Einen halben Meter vor sich stellte er die Fersen auf. Schwarzes Leder, glattpoliert. Vaters Schuhe, schoss es mir durch den Kopf. Ob wohl auch er manchmal Sehnsucht danach hat, sich jemandem anzuvertrauen? Mit einiger Bitterkeit bemerkte ich: Ich wusste weniger über ihn als über den, dessen Namen ich vor knapp drei Stunden erst erfahren hatte. Ein Grund mehr, neben ihm sitzen zu bleiben und ihm erneut, über seine Aktentasche hinweg, zuzunicken.
Читать дальше