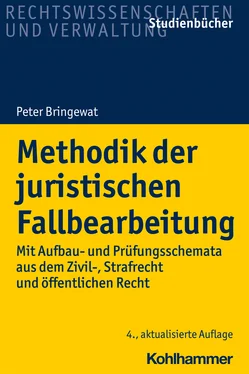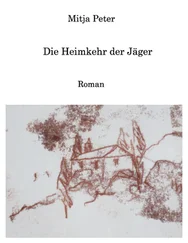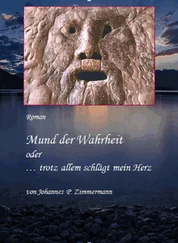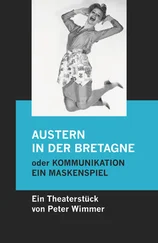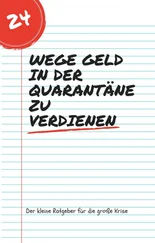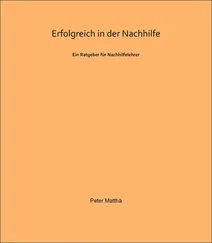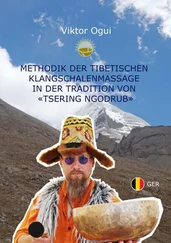64 b) Besonderheit „Anwaltsklausur/-hausarbeit“.Vor vergleichbaren Schwierigkeiten schon bei der Erarbeitung und Ausformulierung konkreter Fallfragen steht man in sog. „Anwaltsklausuren“ oder „-hausarbeiten“. Darunter versteht man Klausuren oder Hausarbeiten, deren Aufgabenstellung in ihrem „Fallfragenteil“ mit der Beratung und/oder sonstigen Tätigkeiten eines beauftragen und (bisweilen) vor Gericht auftretenden Rechtsanwalts verknüpft ist. Die „Verpackung“ der zu bearbeitenden Fallfragen ist in der Regel derartiger Anwaltsklausuren oder -hausarbeiten der letzte Absatz des Sachverhaltstextes mitsamt weiterer Sachverhaltsergänzungen. Fast immer ist darin ein Anspruchsteller oder ein einwendungsberechtigter Anspruchsgegner beschrieben, der in seiner „Rechtsnot“ von seinem Rechtsanwalt hilfreiche Beratung oder die erfolgreiche Durchführung eines Rechtsstreits erwartet und ihm dementsprechend eine Reihe „verkappter“ Fallfragen stellt: „Was wird R dem M wohl raten?“ oder „Welche Erfolgsaussichten hat die von R erhobene Klage?“ etc. sind typische sachverhaltsabschließende Fragen, die wie die allgemeine Fallfrage nach der Rechtslage erheblichen Konkretisierungsaufwand nötig machen.
65In zivilrechtlichen Klausuren und Hausarbeiten ist man dem sog. Anspruchsaufbau (vgl. dazu Zweiter Teil, B. II.) zufolge regelmäßig darauf zurückverwiesen, Fallfragen nach dem Muster des „ Wer will was von wem? “ oder nach dem Schema von „Anspruch und Gegenrecht (Einwendung/Einrede)“ zu erarbeiten. In öffentlich-rechtlichen Klausuren und Hausarbeiten geht es dagegen fast immer um die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs (Rechtsmittels) oder einer Klage, wenn ein Rechtsanwalt befragt oder tätig wird. An den Aufbauregeln für öffentlich-rechtliche Hausarbeiten und Klausuren (vgl. dazu Zweiter Teil, D. I. und II.) orientiert sind dann die zu ermittelnden konkreten Fallfragen wie auch sonst darauf ausgerichtet, Zulässigkeit und Begründetheit von Rechtsbehelfen (Rechtsmitteln) und/oder Klagen an Hand ihrer fallbezogenen und problematischen Einzelelemente zu hinterfragen (näher dazu sogleich).
66 c) Strafrecht und öffentliches Recht.Insgesamt einfacher als im Zivilrecht gestaltet sich die Aufbereitung und Zurüstung von bearbeitbaren Fallfragen in strafrechtlichen und letztlich auch in öffentlich-rechtlichen Hausarbeiten und Klausuren. Die Gründe dafür liegen u. a. in den teilweise andersartigen rechtlichen Grundstrukturen des Strafrechts und des öffentlichen Rechts.
67Strafrechtliche Aufgabenstellungen zeichnen sich nahezu ausnahmslos (etwas anderes gilt wie schon bemerkt bei „Themenklausuren“ oder „-hausarbeiten“) dadurch aus, dass im Fallfragenbereich die Strafbarkeit der im Sachverhalt auftretenden Personen zur Diskussion steht. Da die Strafbarkeitsfrage immer auf die mögliche Begehung bestimmter Delikte und damit auf die Verwirklichung bestimmter gesetzlicher Straftatbestände unter Einschluss allgemeinstrafrechtlicher Strafbarkeitsvoraussetzungen bezogen ist, ergibt sich bei allgemein gehaltenen Fallfragen stets Konkretisierungsbedarf hinsichtlich der verschiedenen Delikte, die begangen worden sind. Als ähnlich konkretisierungsbedürftig kann sich der als Täter oder sonstige Tatbeteiligte in Frage kommende und im Sachverhalt genauer umrissene Personenkreis erweisen.
68Fallfragen wie etwa die unspezifizierte Frage nach der Strafbarkeit aller Beteiligten (vgl. bei Erster Teil, B. II. Fallfrage(n) 4 ) erfordern daher eine Konkretisierung in zweifacher Hinsicht: Zum einen muss der Kreis der Tatbeteiligten ausdifferenziert werden und zum anderen sind die möglicherweise verwirklichten Delikte, und zwar individuell bezogen auf die jeweils einzelnen Tatbeteiligten, zu ermitteln. „Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht“ ist dementsprechend in konkrete Fallfragen wie z. B. „Hat sich A gemäß § 263 StGB strafbar gemacht?“, „Hat sich B gemäß §§ 263, 27 StGB strafbar gemacht?“, „Hat sich C gemäß § 266 StGB strafbar gemacht?“ etc. umzusetzen.
69Auch die Fallfrage(n) 3 bei Erster Teil, B. II., die auf die Begehung von Vermögensdelikten zielt, ist zu konkretisieren; denn als mögliche Straftaten des A kommen Betrug und Untreue (§§ 263, 266 StGB) in Betracht. Doch auch die Umsetzung der Frage „Hat sich A strafbar gemacht?“ in „Hat sich A gemäß § 263 StGB strafbar gemacht?“ und „Hat sich A gemäß § 266 StGB strafbar gemacht?“ ist nur ein erster Schritt zur genaueren Erfassung der Fallfrage(n). Aus dem Sachverhalt 3 bei Erster Teil, B. II. lässt sich nämlich ableiten (zur Arbeit am und mit dem Sachverhalt vgl. Erster Teil, C. II.), dass sich A wegen Betruges auf zweifache Weise strafbar gemacht haben könnte: durch aktives Tun und durch Unterlassen (§ 13 StGB). Demzufolge lauten die „kleingearbeiteten“ Fallfragen: „Hat sich A gemäß § 263 StGB strafbar gemacht?“ und „Hat sich A gemäß §§ 263, 13 StGB strafbar gemacht?“. Im Blick auf strafbare Untreue ist ebenfalls zu differenzieren, und zwar zwischen den beiden Tatbestandsalternativen des Untreuetatbestandes (Missbrauchs- und Treubruchstatbestand) mit entsprechend genauer gefassten Fallfragen: „Hat sich A gemäß § 266 Abs. 1, 1. Alt. StGB strafbar gemacht?“ und „Hat sich A gemäß § 266 Abs. 1, 2. Alt. StGB strafbar gemacht?“
70Grundsätzlich gilt, was die Erarbeitung konkreter Fallfragen betrifft, für öffentlich-rechtliche Klausuren und Hausarbeiten nichts anderes als für strafrechtliche und zivilrechtliche Klausuren und Hausarbeiten. Fallfragen wie „Wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden?“ oder „Beurteilen Sie die Erfolgsaussichten der Klage“ oder „Prüfen Sie die Erfolgsaussichten des Widerspruchs“ oder „Haben die Anträge Aussicht auf Erfolg?“ (vgl. nur die Fallfrage(n) 5 und 6 bei Erster Teil, B., III.) sind in dieser Allgemeinheit nicht zu beantworten. Sie dürfen insbesondere nicht dazu verleiten, im Wege einer allgemeinen Erörterung das Für und Wider von Anträgen, Rechtsbehelfen (Rechtsmitteln) und/oder Klagen mit anschließender Ergebnisformulierung abzuwägen: Die Bearbeitung und Lösung von Rechtsfällen in öffentlich-rechtlichen Klausuren und Hausarbeiten ist kein „Besinnungsaufsatz“.
71Soweit es in den Aufgabenstellungen öffentlich-rechtlicher Hausarbeiten und Klausuren um die rechtliche Beurteilung von Anträgen, Rechtsbehelfen (Rechtsmitteln) und/oder Klagen (verfassungsrechtliche Streitigkeiten, Verfassungsbeschwerde, Bund-Länder-Streit etc. machen keine Ausnahme) geht, wird die Fallbearbeitung und – ihr vorausgehend – die Ermittlung der maßgeblichen Fallfragen nachhaltig von einem bewährten Aufbauprinzip (vgl. zum Aufbau einer öffentlich-rechtlichen Fallbearbeitung Zweiter Teil, D. I. und II.) beherrscht und bestimmt: der Unterscheidung und Unterteilung in einen Merkmalskomplex der „Zulässigkeit“ und einen der „Begründetheit“ von Klagen, Anträgen, Rechtsbehelfen (Rechtsmitteln) etc.
72Wohl deshalb taucht geradezu stereotyp als Einleitung in öffentlich-rechtlichen Fallbearbeitungen der ebenso selbstverständliche wie überflüssige Satz „Die Klage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist“ oder „Der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist“ oder etwas Ähnliches auf. Immerhin: Die „aufbautechnische“ Grobdifferenzierung in Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage, eines Antrages etc. macht deutlich, worauf es bei der Ermittlung der konkreten Fallfragen ankommt. „Hat die Klage Aussicht auf Erfolg“ etc. ist danach zunächst in „Ist die Klage etc. zulässig?“ und „Ist die Klage etc. begründet?“ zu trennen, um sodann in weiteren Konkretisierungsschritten z. B. danach zu fragen „Ist der beschrittene Verwaltungsrechtsweg eröffnet?“ oder „Ist der Kläger K klagebefugt?“. Hierbei handelt es sich um Einzelfragen aus dem Merkmalskomplex der Zulässigkeit, die abgearbeitet sein müssen, um überhaupt in die Begründetheit einer Klage „einsteigen“ zu können. „Ist die Klage begründet?“ bedarf dann in prinzipiell derselben Weise der Zerlegung in Einzelfragen wie z. B. „Verstößt die (zu beurteilende) behördliche Maßnahme gegen Art. 2 Abs. 2 GG?“ oder „Verstößt die behördliche Verfügung gegen Art. 3 Abs. 1 GG?“, wobei mögliche Verstöße gegen Bestimmungen nicht allein des GG, sondern auch alle möglichen anderen Gesetzesverstöße die Bezugspunkte der konkreten Fallfragen aus dem Merkmalskomplex der Begründetheit abgeben können.
Читать дальше