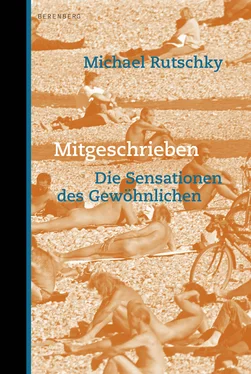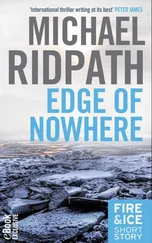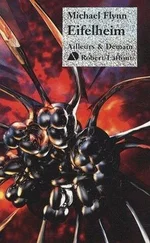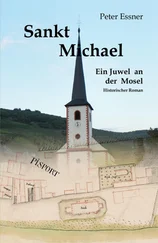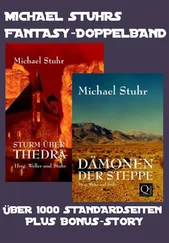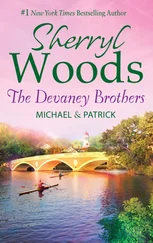Jetzt ist Freyermuth regulär da. Er sitzt in Michels Zimmer, der noch in Frankfurt weilt – »ich habe ihm«, sagt Frau K., ganz Chefin, »das Horx-Manuskript gegeben, zum Auszeichnen. Damit er es mal lernt.«
Am Nachmittag kommt er in das Büro von R. und trägt ihm artig eine Reihe klitzekleiner Probleme vor. Die in Zukunft selber zu lösen R. ihn ermutigt.
Nachdem Gaston Salvatore und Enzensberger eine Reihe von Projekten dargestellt haben, teils begonnene, teils phantasierte, macht Freyermuth zwei Vorschläge. Eine Geschichte über Friedhöfe; eine über Soraya, die ehemalige Kaiserin von Persien.
Die Vorschläge werden nicht abgelehnt; eher zergehen sie in der Diskussion, unvermerkt, so kennt R. es ja, sie lösen sich diskret auf. Als R. am Nachmittag zurückkommt, sitzt Freyermuth an der Schreibmaschine und tippt, Frau K. gibt ihm irgendwelche Ratschläge (»aber das ist doch ein philosophisches Problem«).
Ebenso reagierte R. am Anfang auf die Konferenzen, mit Schreiben. Aber die Texte machten ihn nicht besser präsent, im Gegenteil, seine Hilflosigkeit und Abwesenheit wuchsen an.
R. wacht auf, weil er gerade hingerichtet werden soll, und zwar geköpft, mit einem Gerät, das teils einer Guillotine, teils einer Kreissäge ähnelt. Es war ihm durchaus freundschaftlich eröffnet worden, von Leuten, die nicht nach Polizei oder Justiz aussahen, und in einem Gebäude, das in nichts einem Gefängnis ähnelte.
Es schien bei der Hinrichtung auch weniger um eine Strafe als um eine Art Experiment zu gehen, im Geiste des Kinderspiels durchgeführt: wie man vom Leben zum Tod kommt.
Doch wollte R. daran letzten Endes nicht teilnehmen und wachte auf – vielleicht war eben dies gerade als »Übergang vom Leben zum Tode« dargestellt worden.
Im Bayerischen Hof hängen auf der Empore, die als Fortsetzung der Halle fungiert, Ölbilder prominenter Gäste, Sophia Loren, Roger Moore, Elizabeth Taylor, Farrah Fawcett-Majors.
Die Bilder sind aber nicht im Stil des Fotorealismus gemalt, sondern mit Handschrift, was sie dilettantisch aussehen macht – als wollte das noble Hotel seine prominenten Gäste gut sichtbar veralbern.
»Ich habe gar nicht bemerkt«, so R., in das Zimmer von Michel tretend, »dass Sie wieder da sind.« – »Ich schon«, antwortet er mit dem gewohnten Ausdruck ironischen Leidens.
Schlosscafé Goldegg. »Der Mensch ist die Heimat des Menschen.« – »Ich möchte jetzt häufiger bei mir selbst zu Gast sein.« – »Ich könnte nicht in einem Raum essen, in dem Katzen sind.«
Ein älterer Herr in Begleitung einer Dame, die er womöglich gerade kennenlernt. Philosoph; macht sich seine eigenen Gedanken. Vielleicht ehemals Studienrat – er redet lange darüber, dass er sich jetzt (nach der Pensionierung) nicht mehr in alles einspannen lasse.
Braune Cordhose, weißes Hemd mit feinen blauen Karos, hellgrüner Schlips, Freizeitjacke aus heller Popeline. Später zieht er sich einen Cordmantel mit Gürtel und Schulterklappen an, dazu eine Ledermütze.
Reinhard Hübner, erzählt M. am Telefon, habe in Brasilien erst einen einzigen Auftrag eingeholt; alle anderen Aufträge seien aus der Bundesrepublik, also über seinen Vater gekommen.
Außerdem habe er eine Unmenge Seide gekauft, um einen Ballon zu bauen, der durch einen Tretmotor bewegt werden solle – wie das funktioniert, weiß M. nicht zu sagen, es soll ja auch bedeuten, dass Reinhard Hübner spinnt. Irgendjemand bemerkte neulich, Reinhard Hübner habe seinen Beruf verfehlt.
Eigentlich, erzählt Freyermuth, habe er geplant, mit 21 zu promovieren – wie Adorno. Als er kurz vor dem entsprechenden Geburtstag einsah, dass daraus nichts würde, habe er umdisponiert: mit 30 müsse er auf jeden Fall habilitiert sein. Ein Tutorium über Schnitzler im Hinblick auf Peter Szondis Theorie des modernen Dramas habe er von Professor Lämmert bloß deshalb erhalten, weil der gerade Szondis Nachfolger geworden war. Er, Lämmert, habe es ihm, Freyermuth, geben müssen, weil die alten Szondi-Schüler den Kopf schüttelten über so viel Hybris eines so jungen Mannes. Der Tutor Freyermuth signalisierte ihnen den Anbruch einer neuen Herrschaft. Und so weiter.
Kathrin, Scheel und R. gehen die Treppe hinunter; Gabi Dürr und Goetz schauen ihnen nach, dann gehen sie zusammen in seine Wohnung zurück. In diesem Augenblick weiß R. genau, dass sie regelmäßig miteinander schlafen.
»Und grüßen Sie die Katharina!«, strahlt Frau K. heiter, als R. sich verabschiedet. Das wagte sie noch nie.
Es erklärt sich daraus, dass eine amerikanische Journalistin die Redaktion besuchte, der R., als der am besten Englisch Sprechende, Absichten und Machart der Zeitschrift so erklärte, dass Frau K. zufrieden war, in sich nichts verspürte, was sie als Stellvertreterin Enzensbergers hätte einwenden müssen (Michel ist am Nachmittag nach Frankfurt gereist).
Den Ton, in dem Frau K. den Gruß an Kathrin bestellt, nannte man früher »leutselig«.
Berlin. Während sein Vater, Kathrin und R. an dem runden Tisch mit den Resten des Abendessens sitzen und reden, betrachtet sie Onno Norps ausgiebig durch das Teleobjektiv der Kamera von R., unbewegt an der Tür stehend.
Wahrscheinlich nimmt er jeden Einzelnen aufs Korn – aber als er abdrückt, weiß R. nicht, wen es getroffen hat.
Frauke, seine Frau, erzählt Henning Norps, sei ausgezogen, um endlich einmal herauszufinden, was sie selber meine und wolle. Weder zur Politik noch zur Literatur oder auch nur zu Fragen der Kleidermode besaß sie jemals eine eigene Meinung; immer habe sie nur das gemeint, was andere ihr vorsagten.
»Das nennt man im Allgemeinen«, sagt Kathrin, »eine schwere Depression.« – Ja, sagt Henning Norps, und ihn habe sie – zunächst für ein halbes Jahr – verlassen, weil er für sie auch bloß einer von den Vorsagern sei.
»Und jetzt bin ich allein mit meinen Gefühlen«, fährt er fort und schaut R. dringlich an, »mit meinen Liebesgefühlen.« Auf die Dringlichkeit weiß R. nicht zu reagieren und antwortet hilflos kulturgeschichtlich. »Früher war es ja genau umgekehrt; da verließen die Männer die Frauen, und die blieben auf ihren Affekten sitzen.«
Seine letzte Freundin, erzählt Mathias Greffrath, übertraf ihn bei weitem an Größe und Gewicht; so etwas mache viel aus, »flächendeckende Zärtlichkeiten«. Das müsse auch Krista, seine geschiedene Frau, zu diesem Richter hingezogen haben; schließlich wirke der Mann wie ein Baum.
Seine, Mathias’, nächste Freundin müsse jedenfalls vom Lande kommen – »eine MTA«, schlägt R. vor –, ja, und sie dürfe das Wort »Identitätsprobleme« noch nie gehört haben, sie könnte es noch nicht einmal buchstabieren. Dafür würde sie ihm alle Mahlzeiten kochen und zwischendurch immer wieder ein Glas heiße Milch ins Arbeitszimmer bringen.
Als sie aufhörte, bei der Fluggesellschaft zu arbeiten, erzählt Vera Xander, habe sie angenommen, jetzt werde ihr Mann, Curt, ins Examen starten.
Doch nichts geschah. Da ging sie selber in das Institut und erkundigte sich: Sie erfuhr, dass Curt Xander mit dem Examen gar nicht starten konnte, denn er hatte noch nicht einmal die Zwischenprüfung absolviert. Und ihr war sofort klar, dass er sie auch nicht nachholen würde. – Nein, ihn selber habe sie, Vera Xander, nicht befragt zu der Sache.
Diese Nonchalance von Curt Xander, sagt Vera Xander, habe ihr immer so imponiert – wozu soll man ein Examen machen? Kann man nicht ohne Examen, kann man nicht anders leben? Weit stärker als Jura interessiert ihn doch seine Malerei …
Wenn sie, Vera, jetzt ihr Examen auf jeden Fall schaffen will, erklärt sich das einfach daraus, dass sie eine Sache, die sie angefangen hat, unbedingt zu Ende bringen muss. Ein Abbruch würde sie unerträglich quälen. Aber das sei halt ihre höchstpersönliche Einstellung und für ihren Mann nicht verpflichtend.
Читать дальше