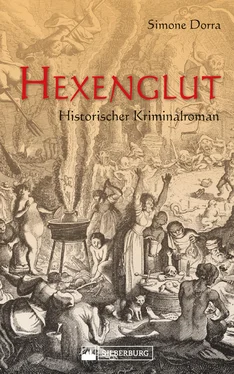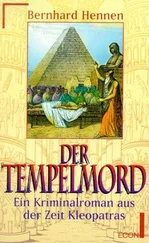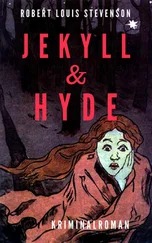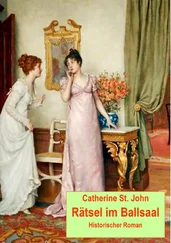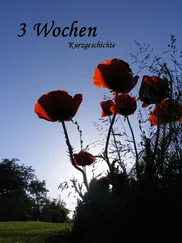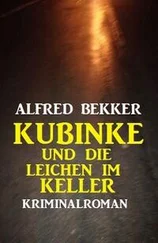»Weil Ihr mit Regula sowieso schon alle Hände voll zu tun hattet«, meinte Heinrich Stöcklin gelassen. »Ich habe einen Apotheker, der mich zuverlässig mit Fingerhutessenz versorgt. Die Rezeptur stammt noch von dem alten Medikus vor dem unseligen Michel Sebald, dem wir Regulas ›Heilmittel‹ verdanken. Und der Apotheker ist ein alter Freund, dem ich vertraue … nicht der Panscher, bei dem die Zofe und die Köchin immer die Flaschen mit diesem Teufelszeug geholt haben.«
Und der an Regulas Leiden wahrscheinlich ebenso gut verdient hat wie Sebald, dachte Fidelitas.
»Trotzdem: Falls ich Euch in irgendeiner Weise helfen kann, sagt es mir«, meinte sie. »Solange ich noch hier bin, meine ich.«
»Aber gewiss.« Die Augen des alten Herrn funkelten verschmitzt. »Und Ihr habt mir schon geholfen, Schwester. Mit einer gesunden Regula an seiner Seite wird es Vinzenz viel leichter fallen, sich gegen Gundis durchzusetzen. Das gibt ihm mehr Selbstvertrauen. Und es wird meinem willensstarken Weib bestimmt nicht schaden, ein wenig zurückzustecken. – Habt Ihr eigentlich das Münster schon besucht?«
Fidelitas schüttelte den Kopf. »Nein. Mir hat bisher die Zeit gefehlt.«
»Das müsst Ihr unbedingt nachholen.« Die Stimme von Heinrich Stöcklin wurde lebhaft. »Es hat mehr als dreihundert Jahre gedauert, es zu errichten, und noch immer wird daran gebaut … Im Moment entsteht gerade eine neue Vorhalle, an der Südfassade.«
Er lachte.
»Der Freiburger Rat hat vor achtzig Jahren schon darüber geklagt, dass das Chorgewölbe viel zu kostspielig und immer noch nicht fertig war … und vor fünfundvierzig Jahren Gott dafür gedankt, dass der letzte Stein endlich eingefügt worden ist. Ihr seht, nicht nur meine Gundis schaut geizig auf jeden einzelnen Gulden.«
»Ihr habt recht.« Fidelitas erhob sich. »Ich muss unbedingt dorthin; vielleicht habe ich morgen endlich die Gelegenheit dazu.«
Sie lächelte Heinrich Stöcklin an, verneigte sich und ließ ihn mit seinen Büchern allein. Als sie kurze Zeit später in ihrem Zimmer die Laudes gesprochen hatte und vor dem Schlafen noch ein wenig in ihrem Buch mit den Kräuterrezepten der Hildegard von Bingen blättern wollte, das sie aus Frauenalb mitgebracht hatte, stellte sie fest, dass sie es wohl bei Irmhild in der Küche vergessen haben musste. Seufzend machte sie sich mit ihrer Kerze auf den Weg nach unten, so lautlos wie möglich, um den Rest der Familie, der sich längst zurückgezogen hatte, nicht zu stören.
In der stillen, leeren Küche führte das Licht der Kerzenflamme sie zum sauber geschrubbten Tisch, auf dem das Buch noch immer lag, und sie steckte es in die Tasche ihrer Tunika. Als sie auf dem Rückweg an der Haustür vorbeikam, hörte sie erst ein leises Kratzen und dann das unverkennbare Klirren eines Schlüssels, der ins Schloss gesteckt wurde. Das kam von draußen. Sie blieb stehen und blies instinktiv die Kerze aus.
Dann trat sie zur Seite und wartete, den eigenen Herzschlag als rasches Hämmern in den Ohren. Die Haustür quietschte und öffnete sich, erst einen kleinen Spalt, dann weiter. Vor wenigen Minuten hatte die Turmuhr des Münsters zehn geschlagen, und das schwache Restlicht der Abenddämmerung zeigte ihr eine schlanke, zierliche Gestalt, die hereinschlüpfte und die Tür vorsichtig wieder hinter sich zuzog. Mit einem Klicken wurde der Riegel vorgelegt, dann hörte sie, wie jemand tief und erleichtert durchatmete.
Fidelitas machte einen raschen Schritt vorwärts, streckte die Hand aus und bekam weichen Stoff zu fassen. Ein leiser Schreckensschrei und ein panisch geflüstertes »Heilige Mutter Gottes!« Fidelitas schnappte verblüfft nach Luft, als sie die Stimme erkannte.
»Veronika? Wieso seid Ihr so spät noch unterwegs – und wo seid Ihr gewesen?«
Sekundenlange Stille, dann ein schwerer Seufzer.
»Das … das kann ich Euch nicht sagen. Aber bitte, bitte … verratet mich nicht!«
Fidelitas überlegte.
»Ich werde Euch nichts versprechen«, erwiderte sie endlich. »Nicht, ehe ich weiß, wieso Ihr Euch zu einer Zeit ins Haus schleicht, in der jede vernünftige Jungfer längst in ihrem Bett liegen sollte.«
Sie ließ Veronikas Mantel los und nahm ihren Arm.
»Kommt mit mir hinunter in die Küche; es ist bestimmt noch etwas Glut im Herd, an der ich meine Kerze anzünden und Euch ansehen kann, während wir miteinander reden.«

Manchmal wünschte sich Veronika Stöcklin, sie wäre nicht als Mädchen geboren worden.
Ihre Freundinnen – Töchter von Ratsherren und wohlhabenden Kaufleuten in Freiburg – beneideten sie von jeher um ihre Schönheit und ihre guten Aussichten. Veronika fand inzwischen keines von beidem mehr sonderlich beneidenswert.
Im letzten Dezember war sie siebzehn geworden, und ihre Großmutter Gundis hatte diesen Geburtstag zum Anlass genommen, ernsthaft nach einer guten Partie für sie zu suchen. Wobei sie nicht lange suchen musste – der gewünschte Ehemann für ihre Enkeltochter hatte eigentlich schon festgestanden, als Veronika ihre Pausbacken und ihre kindliche Unbeholfenheit verlor, als ihre Gestalt zierlich und anziehend wurde und die jungen Burschen in den Gassen anfingen, ihr nachzustarren, wenn sie vorüberging. Und das war jetzt gut zwei Jahre her.
Im März hatte Gundis sie zu sich gerufen und ihr erklärt, wen genau sie zum Mann nehmen sollte – Martin Danner, den ältesten Sohn von Sebaldus Danner. Dieser war genau wie Vinzenz Stöcklin ein erfolgreicher Tuchhändler gewesen und letztes Jahr einem Schlaganfall erlegen. Gundis glaubte offensichtlich, dass die Ehe mit Sebaldus' Erben das Vermögen der Stöcklins so stark mehren würde, dass es sich gar nicht erst lohnte, im Kreise der angesehenen Ratsherren nach einem anderen Kandidaten für Veronika Ausschau zu halten. Das passte zu ihr – der jahrzehntelang heiß ersehnte und hart erarbeitete Aufstieg in die besseren Kreise von Freiburg war längst gelungen, jetzt hieß es, durch möglichst großen Reichtum dafür zu sorgen, dass es nie wieder zu einem Abstieg kam.
Veronika verstand das durchaus. Gundis wollte den Status der Familie sichern, koste es, was es wolle – und Veronika war das Mittel, mit dem sich genau dieses Ziel erreichen ließ. Das einzige Mittel – denn Veronikas Mutter Regula war es leider nicht gelungen, einen männlichen Erben zur Welt zu bringen, der den einträglichen Tuchhandel von Vinzenz Stöcklin eines Tages übernehmen konnte. Gundis hatte sie das deutlich spüren lassen.
Regula ihrerseits hatte die Tyrannei und die ständigen giftigen Vorwürfe ihrer Schwiegermutter nur schwer ertragen, sich aber selten wirklich zur Wehr gesetzt, um ihrem Mann – den sie innig liebte – das Leben nicht schwer zu machen.
Also war Veronika den Wünschen ihrer Großmutter mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Noch hatte Gundis den Termin der Hochzeit mit Martin Danner nicht festgesetzt – was ausschließlich daran lag, dass der Tod seines Vaters erst sechs Monate zurücklag und ein großes Fest sich nicht mit der Trauerzeit vertrug. Aber Martin kam häufig zu Besuch und bewegte sich (wenigstens in Veronikas Augen) durch das Haus, als gehörte es bereits ihm – was eines Tages zwangsläufig der Fall sein würde, weil Veronikas Erbe nach der Hochzeit nach herrschendem Recht genauso an ihn fallen würde wie alles, was sie sonst noch besaß.
Dass Vinzenz Stöcklin nach dem Überfall auf seiner Reise durch den Schwarzwald gottlob gesund und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt war, änderte nichts an Gundis' Plänen. Dass die Nonne, die ihn begleitete, es tatsächlich fertiggebracht hatte, Veronikas Mutter aus dem gleichgültigen Nebel herauszuholen, in dem sie vor zwei Jahren versunken war, ebenso wenig. Veronika glaubte, dass Regula noch viel zu schwach und zu anfällig war, um den Kampf mit Gundis wieder aufzunehmen. Und sie war viel zu erleichtert, sie zurückzuhaben, und auch viel zu besorgt um ihr Wohlergehen, um ihr diesen Kampf jetzt zuzumuten.
Читать дальше