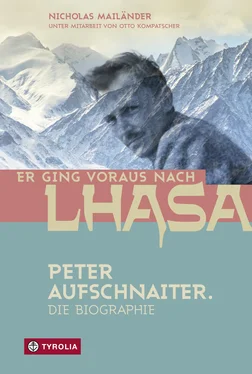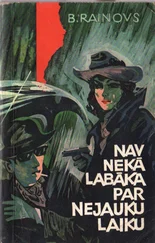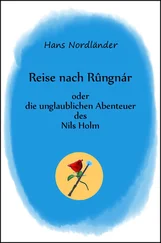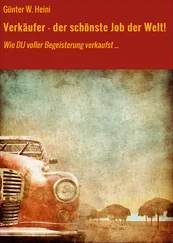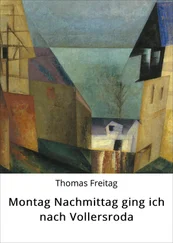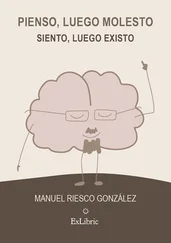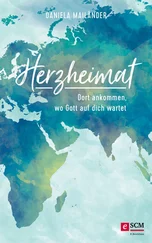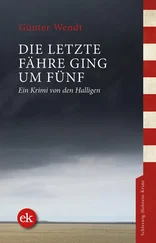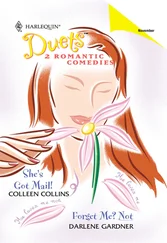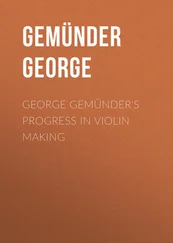Als Fritz Bechtold die Nanga-Parbat-Kundfahrt 1934 nach ihrem tragischen Ende in die Heimat zurückgebracht hatte, tat er sich mit Paul Bauer zusammen, und beide setzten einen Gedanken in die Tat um, der bei den Teilnehmern der beiden Kantschfahrten schon lange im Keim vorhanden gewesen war: Sie schufen einen Mittelpunkt für die deutschen Himalaja-Unternehmungen, der in den Wechselfällen des Schicksals mehr Beständigkeit hat als das Leben eines einzelnen. Bechtold und Bauer gründeten im Verein mit dem Reichssportführer die Deutsche Himalaja-Stiftung. Der Reichssportführer stattete sie mit RM 5000.– aus, Fritz Bechtold stiftete RM 5000.– aus den Erträgnissen des ersten Nanga-Parbat-Films, Paul Bauer stiftete gleichfalls RM 5000. – aus den Honoraren für Bücher, Veröffentlichungen und Vorträgen über die beiden Kantschfahrten, die er verwaltete. […]
Im Mai 1936 wurde die Stiftung von der Regierung genehmigt mit dem Zweck, bergsteigerische Kundfahrten in den Himalaja und andere entlegene Gebirge durchzuführen und zu fördern und Mittel für diesen Zweck zu werben. […]
Noch im Jahre ihrer Gründung, 1936, rüstete die Stiftung eine Rundfahrt in den Sikkim-Himalaja aus, die bergsteigerisch sehr interessante Ergebnisse brachte und der vor allem zur Überraschung der gesamten Bergsteigerwelt die Ersteigung des bis dahin für unmöglich angesehenen Siniolchu gelang. […] 36
Abgesehen davon, dass diese Schilderung ein Musterbeispiel ist für die Umdeutung einer feindlichen Übernahme in eine der Förderung des Bergsteigens verpflichtete Mission, enthält sie auch eine aufschlussreiche sachliche Ungenauigkeit. Denn tatsächlich begannen die Vorbereitungen für die Kundfahrt zum Siniolchu nicht erst 1936, sondern sie waren bereits Ende November 1935 in vollem Gang. Dies geht aus einem in englischer Sprache verfassten Brief an den Privatsekretär Seiner Hoheit des nepalesischen Maharaja in Kathmandu hervor, den Paul Bauer am 27. November 1935 unterzeichnete:
„[…] eine kleine Gruppe von drei oder vier deutschen Bergsteigern unter meinem Kommando beabsichtigt zwischen den Monaten August und Oktober nächsten Jahres, 1936, die Besteigung einer Reihe von hohen Bergen durchzuführen, die an der Grenze zwischen Sikkim und Nepal, liegen – nicht jedoch des Gipfels des Kangchenjunga selbst. […] Wir […] bitten demütig darum, sollte dies notwendig sein um Leben zu retten, mit Erlaubnis Seiner Hoheit nepalesischen Boden betreten zu dürfen, wobei wir versprechen, das Territorium Nepals so schnell wie möglich zu verlassen und nach Sikkim zurückzukehren über die Pässe Lhonak La, Jonsong La oder Kambachen, Tseram, Talung La oder Kann La. […] Ich vertraue darauf, dass Ihre Hoheit geneigt sein dürfte, unsere Anfrage zustimmend zu beantworten.
Ich habe die Ehre, sehr geehrter Herr, als Euer allergehorsamster Diener zu verbleiben.
Paul Bauer
Führer der Deutschen Himalaja
Expeditionen 1929 und 1931“ 37
Höchstwahrscheinlich dürfte der Unterzeichnende diese ehrerbietigen Zeilen nicht selbst verfasst haben, sondern sein Freund Peter Aufschnaiter.
Da im AAVM-Jahresbericht 1934/35 als Wohnort von Peter Aufschnaiter zum Stichtag 1. November 1935 noch St. Johann in Tirol genannt wird 38, ist es anzunehmen, dass er im Laufe des Monats wieder nach München übersiedelte, um die für den Sommer 1936 geplante Siniolchu-Kundfahrt seines Förderers vorzubereiten. Vorerst dürfte Aufschnaiter jedoch hauptsächlich als Geschäftsführer des AAVM tätig gewesen sein, betraut mit der ehrenvollen Aufgabe, den notorisch auf seine Eigenständigkeit versessenen Akademikerklub als Sektion in den DuÖAV und damit in den Deutschen Bergsteigerverband einzugliedern. 39

Die Rakhiotflanke des Nanga Parbat, von der Gegend um die Märchenwiese aus gesehen .
Die Deutsche Himalaja-Stiftung wurde am 28. Mai 1936 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus in München genehmigt und in das Verzeichnis der von der Regierung von Oberbayern zu beaufsichtigenden Stiftungen aufgenommen. 40Reichssportführer von Tschammer und Osten bestellte Fritz Bechtold zum Vorstand der Stiftung. 41Diese war zwar de jure eine selbständige Institution. Die Entscheidungsgewalt über die Aktivitäten der Stiftung lag jedoch beim Reichssportführer, der die Weisungsbefugnis an Paul Bauer als Chef des Fachamtes Bergsteigen übertrug. De facto war die Deutsche Himalaja-Stiftung im Dritten Reich damit nichts anderes als die für Auslandsbergfahrten zuständige Abteilung des nationalsozialistischen Fachamtes für Bergsteigen – geleitet von Peter Aufschnaiter.
Im März 1936 hatte Paul Bauer den jungen Münchner Spitzenbergsteiger Adolf Göttner zur Teilnahme an einer Himalaya-Kundfahrt in das Gebiet des Kangchenjunga eingeladen, die auf die Erstbesteigung des markanten Sechstausenders Siniolchu abzielte. Die Bauer-Vertrauten Günther Hepp und Karl Wien vervollständigten das kleine Expeditionsteam, das sich vorgenommen hatte, zwei eindrucksvolle Gipfel im Sikkim-Himalaya zu besteigen: den Tent Peak sowie den als „schönsten Berg der Welt“ bezeichneten Siniolchu. Bauer verfolgte damit weitergehende Ziele: „Wir wollten dort erproben, welche Möglichkeiten sich einer kleinen, leicht beweglichen Mannschaft bieten würden, zugleich wollten wir den Führer und die Kernmannschaft für den beabsichtigten dritten Angriff auf den Nanga Parbat schulen und Ausrüstung, Lebensmittel und Angriffsmethoden hierfür nochmals eingehend prüfen und verbessern.“ 42Instabiles Wetter drohte dem schlagkräftigen Quartett die hochgesteckten Pläne zu vereiteln. Ihren Versuch am Tent Peak mussten Göttner und Wien wegen erheblicher Lawinengefahr abbrechen.
Nach sechs Schlechtwettertagen im Basislager starteten die vier am 21. September 1936 den entscheidenden Versuch am Siniolchu. Bauer, Wien, Hepp und Göttner gingen den schwierigen Sechstausender im Alpinstil an. Abends hackten sie in rund 6400 Metern Meereshöhe auf dem steilen, stark überwechteten Westgrat Sitze in den Firn und harrten auf den Morgen. Um acht Uhr in der Früh erreichte das Team die Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel. Hier blieben Bauer und Hepp zurück, um der Gipfelmannschaft „den Rückzug zu sichern“. Sechs Stunden später durchschlug Göttner die Gipfelwechte und betrat den höchsten Punkt: 6887 Meter. Die Bergsteiger befestigten einen „Hakenkreuzwimpel am Eispickel und schwenkten ihn laut jubelnd“, um ihren Kameraden in der Scharte den Erfolg zu melden. 43
Paul Bauer hatte wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur ein gewiefter alpinpolitischer Strippenzieher war, sondern auch ein hervorragender Bergsteiger und umsichtiger Expeditionsleiter!
Der gelernte Schildermaler Adolf Göttner hatte zusammen mit anderen Jungmannschaftsmitgliedern der DuÖAV-Sektion München – hier sind vor allem Ludwig Schmaderer, Martin Meier, Herbert Paidar, Josef Thürstein, Otto Eidenschink, Gottlieb Rosenschon, Alfred Seidl, Rudolf Unterberger sowie die Brüder Ludwig und August Vörg zu nennen – durch hervorragende Leistungen in den Alpen auf sich aufmerksam gemacht. Finanziert vor allem durch die Sektion München, fuhren Göttner, Rosenschon, Schmaderer und Vörg im Juni 1935 mit der Eisenbahn in den Kaukasus. Hier gelangen mehrere Erstbesteigungen. Elbrus und Kasbek wurden erstiegen. Krönung war die Überschreitung der beiden Uschbagipfel erstmals von Süden nach Norden. 44Im Sommer 1936 hatte Adolf Göttner eigentlich an einer weiteren Kundfahrt der Münchner Jungmannschaft teilnehmen wollen, hatte aber kurzfristig die Chance ergriffen, mit Paul Bauer zum Siniolchu zu fahren. 45
So reisten seine Kameraden Schmaderer, Vörg, Thürstein und Herbert Paidar ohne ihn in den Kaukasus. Mit den ersten Durchsteigungen der Nordwand des Schchelditau durch Schmaderer und Paidar sowie der 2000 Meter hohen extrem schwierigen Westwand des Uschba durch Schmaderer und Vörg eröffneten die jungen Münchner eine neue Ära in der Geschichte des Kaukasusbergsteigens. 46
Читать дальше