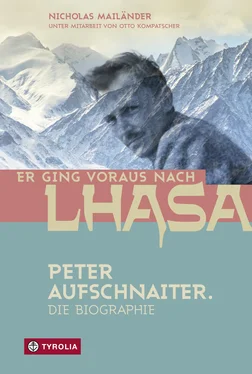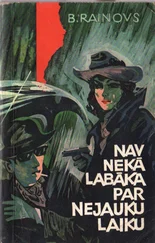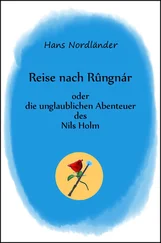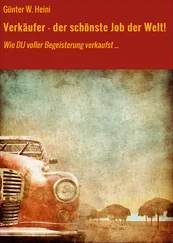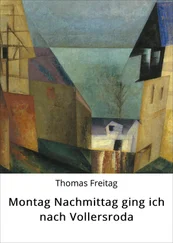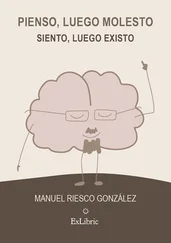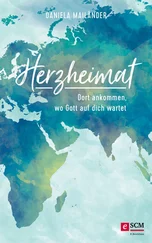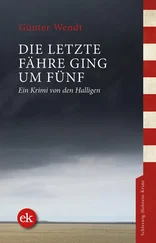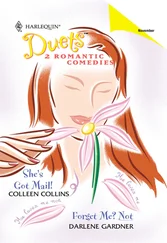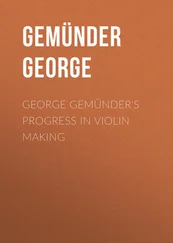Ein weiterer überzeugter Nationalsozialist aus den Reihen des AAVM war der Kantsch-Veteran Karl „Kai“ von Kraus. Heinz Tillmann berichtete, dass ihn politische Unbotmäßigkeiten in seinem Umfeld zur Drohung veranlassten, „Ich bring“ Sie (oder dich) nach Dachau!“ 14Kraus war Generalarzt des Roten Kreuzes. Als er in dieser Eigenschaft einmal mit einem schweren Wagen à la Maybach beim AAVM vorfuhr, soll er von seinen Kameraden schallend ausgelacht worden sein. 15Eine der berühmten Kneipzeitungen des AAVM enthält folgenden auf „Kai“ von Kraus gemünzten Spottvers:
„Politik ist jetzt sei Leibspeis,
Rabiat wird er ganz geschwind,
Und er droht dir gleich mit Dachau,
Wenn er was nicht schicklich find.“ 16
Auch der zu verbandspolitischen und anderweitigen Ehren gelangte Eugen Allwein bekam sein Fett ab: „Leidgeprüft und als ein Wissender meistert er jetzt die Welt: Unser Alisi, V. in der S.H. des DÖAV, Mitglied im VWA und M. des AAVM, zugleich J.J.A. und D. in der Gem. Haidh., H.V.B. des RBL.“ 17Es ist bemerkenswert, dass Paul Bauer, einst regelmäßig beißendem Spott ausgesetzt, nach 1933 geschont wurde.
Hinweise auf Peter Aufschnaiter sucht man in den AAVM-Kneipzeitungen zwischen 1933 und 1935 vergeblich. Laut dem 1933 veröffentlichten Jahresbericht des AAVM lebte Aufschnaiter im Herbst des Jahres in München. 18Am 22. April 1933 war der Diplomlandwirt in St. Johann in Tirol der NSDAP beigetreten und wurde unter der Mitgliedsnummer 1605636 geführt. 19Ein Foto aus dieser Zeit zeigt ihn, einer damals in Süddeutschland und Österreich weit verbreiteten Mode entsprechend, mit kleinem Schnauzbart und Rechtsscheitel. Während seine besten Freunde in wichtigen Positionen am Aufbau des „Dritten Reiches“ mitwirkten, zog sich Peter Aufschnaiter in den Jahren 1933 bis 1935 aus unbekannten Gründen in die Heimatgemeinde seiner Mutter, St. Johann in Tirol, zurück.
Vor allem dem politisch zuverlässigen und hocheffizienten Paul Bauer wurden von den neuen Machthabern anspruchsvolle Aufgaben anvertraut. Nachdem alle deutschen Alpenvereinssektionen dem Deutschen Bergsteiger- und Wanderverband bis Ende 1933 beigetreten waren, machte sich Verbandsführer Bauer an die Eingliederung der Mitglieder des traditionell sozialdemokratischen Touristenvereins „Die Naturfreunde“ in das neu entstandene Zwangssystem des deutschen Sports. Zwar hatte die TVDN-Reichsleitung unter Xaver Steinberger versucht, den Arbeiterverein als gleichgeschalteten Verband zu erhalten, obwohl seine Tätigkeit kurz nach der Machtübernahme verboten und das Vereinsvermögen eingezogen worden war. Als eine gründliche Ausforschung der TVDN-Ortsgruppen durch die Gestapo ergeben hatte, dass sich die Basis der Naturfreunde wesentlich weniger anpassungsfähig zeigte als die Vorstandsetage, wurde der Verband am 28. Februar 1934 offiziell aufgelöst. Seine Mitglieder kamen zum Teil in Alpenvereinssektionen unter, meist aber in lokalen Wandervereinen, die den Genossen eher die Freiheit ließen, ihr Naturerleben gemäß den althergebrachten Naturfreunde-Traditionen zu gestalten. 20
Um die „Abwicklung“ ihres Verbandsvermögens zu bewerkstelligen, wurde Notar Bauer am 28. April 1934 zum Reichstreuhänder für den Touristenverein „Die Naturfreunde“ ernannt. Der DuÖAV-Hauptverein hatte deutlich gemacht, dass er mit dieser Angelegenheit nichts zu tun haben wollte, und beschränkte sich auf die Empfehlung an seine Sektionen, den Eintritt ehemaliger Naturfreunde so weit wie möglich zu erleichtern. 21Unter den Münchner Alpenvereinssektionen zeigte nur die Sektion Hochland für den Immobilienbestand der Naturfreunde Interesse: Im Sommer 1934 übernahm sie „pachtweise“ die Wimbachgrieshütte. Die meisten Naturfreundehäuser wurden dem Jugendherbergswerk übertragen, andere als Schulungsstätten der NS-Organisationen genutzt, einige von Privatpersonen gekauft. 22Der Sektion München hatte Paul Bauer – um eine „streng vertrauliche Behandlung der Angelegenheit“ bittend 23– ebenfalls den Erwerb zweier Naturfreundehäuser angeboten. Sowohl aus „rechtlichen als auch aus wirtschaftlichen Erwägungen“ lehnte der Beirat der Sektion das amtliche Ersuchen jedoch „vorerst“ ab. 24
Aufgrund ihres Engagements beim Aufbau der nationalsozialistischen Herrschaftsstrukturen konnten weder Paul Bauer noch seine Getreuen die Zeit für einen weiteren Versuch an einem Achttausender erübrigen. Dagegen wussten ihre Konkurrenten um Willy Merkl und Willo Welzenbach den neuen Wind im Land geschickt für ihre bergsteigerischen Zwecke zu nutzen.

Abschied von Alfred Drexel auf dem Münchner Hauptbahnhof – für immer .
Im Gegensatz zur ersten deutschen Nanga-Parbat-Expedition im Jahr 1932 schöpfte das für 1934 geplante Unternehmen finanziell aus dem Vollen. Für die nationalsozialistische Propaganda war die Besteigung dieses Achttausenders ein hochwillkommener Anlass, der Welt gegenüber die Leistungsfähigkeit des Hitlerregimes unter Beweis zu stellen. Obwohl die meisten der Bergsteiger der Expedition das nationalsozialistische Gedankengut ablehnten, nahmen sie die politische Instrumentalisierung der Expedition hin, um ihre alpinistischen Zielsetzungen zu verwirklichen. Schweren Herzens fügte sich Welzenbach der Tatsache, dass der von ihm als organisatorisch unfähig eingeschätzte Willy Merkl die Leitung der Expedition übernehmen würde. Bei der Auswahl seiner Mannschaft bewies Merkl allerdings eine glückliche Hand. Mit Erwin Schneider, Peter Aschenbrenner, Alfred Drexel, Fritz Bechtold und Uli Wieland waren einige der besten Bergsteiger in Deutschland und Österreich vertreten. Dass die Machthaber in Berlin den Erfolg am Nanga Parbat nicht als eine Privatsache der Alpinisten betrachteten, machte Reichssportführer von Tschammer und Osten überdeutlich: „Die Eroberung des Gipfels wird zum Ruhme Deutschlands erwartet.“ 25
Wegen der Führungsschwäche des Expeditionsleiters wurde kostbare Zeit vergeudet. Erst am 4. Juli drangen Merkl, Wieland, Bechtold und Welzenbach auf die bereits 1932 erreichte Höhe von 7000 Metern vor. Welzenbach war mit der Vorgehensweise immer noch äußerst unzufrieden. Das durch Merkl – gemäß den Wünschen der nazistischen Machthaber – angestrebte Ziel, möglichst die gesamte Expeditionsmannschaft gemeinsam auf den Gipfel zu bringen, führte zu unlösbaren logistischen Problemen. Als analytischer Kopf machte sich Welzenbach keine Illusionen: „Man kann nicht einen Verein von zehn bis zwölf Leuten auf einen Achttausender bringen wollen. Dann kommt eben keiner hinauf. Aber alles Predigen ist hier vergeblich. Willy weiß alles besser. […] Ich setze große Hoffnung auf Schneider und Aschenbrenner, die mit ihrer Büffelnatur uns vielleicht doch noch den Erfolg erringen helfen.“ 26
Bereits am 6. Juli drangen Schneider und Aschenbrenner bis knapp unter die 8000-Meter-Grenze vor und warteten dort vier Stunden lang auf ihre Kameraden. In der festen Überzeugung, am folgenden Tag den Gipfel erreichen zu können, verbrachten die beiden dann zusammen mit Welzenbach, Merkl und Wieland sowie fast allen Hochträgern die Nacht im Lager 8 auf rund 7500 Meter knapp über dem Silbersattel. Noch waren alle bester Dinge. Erwin Schneider berichtete: „Abends singen wir in den Zelten, kaum können wir den Morgen erwarten. Früh um 5 Uhr sehe ich aus dem Zelt, es ist noch klar. Um 7 Uhr, als wir aufbrechen wollen, tobt ein furchtbares Schneetreiben um unsere Zelte. Das Schicksal hat sich gegen uns entschieden.“ 27
Von den sieben Sherpas und fünf „Sahibs“, die sich am 6. Juli 1934 im Lager 8 in die Startlöcher für den Gipfelsturm begeben hatten, überlebten nur Aschenbrenner, Schneider und der Sherpa Ang Tshering den fürchterlichen Wettersturz. Der Sherpa Gay-Lay hätte sich vielleicht retten können, zog es aber vor, bei seinem Bara-Sahib Willy Merkl auszuharren. Dem Expeditionsmitglied Fritz Bechtold blieb nichts anderes übrig, als die Überlebenden der gescheiterten Expedition in die Heimat zurückzuführen. Die drei am Nordgrat des Nanga Parbat verstorbenen Bergsteiger – Opfer einer Kombination von fehlerhafter Expeditionsplanung und Wetterpech – wurden von der Presse in Deutschland zu Nationalhelden hochstilisiert, die zur Ehre des Vaterlands gefallen seien.
Читать дальше