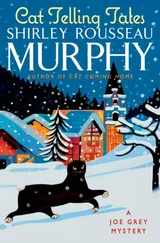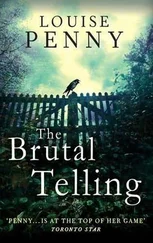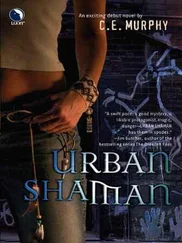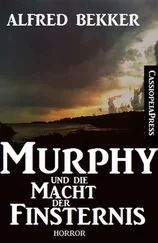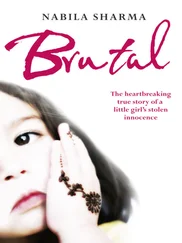Ich sah Schmerz in seinen Augen und nahm einen Schluck. Ja, es schmeckte tatsächlich scheiße, aber mit einer Schachtel Pfadfinderkeksen dazu war das Frühstück nur halb so schlimm.
Robert riss sich schnell zusammen.
»Okay, wir setzen Segel und schauen uns die Insel an. Normalerweise gibt es dort weniger als hundert Menschen, aber mit Touristen und Flüchtlingen, erwarte ich eine ganze Menge mehr. Wenn sie sich organisiert haben, wer weiß das schon? Was denkst du?«
»Nun, wir werden ein paar Vorräte brauchen, bevor wir losziehen. Wir haben kaum noch Batterien.«
»Und Dewars . Lass uns als Nächstes in Tenants Harbor anlegen.«
Er ertappte mich beim Nachdenken und sah mich streng an. »Du weißt, dass wir weder Diebe noch Piraten sind.« Er lachte kurz auf und ich warf ihm einen Blick zu, der sagte: kein Scheiß .
»Wir sind Überlebende«, sagte ich. »Unsere moralische Verpflichtung liegt bei den Lebenden, den richtigen Menschen. Die Anderen sind nur … sehr gefährliche Tiere.«
Ich beschäftigte mich mit den Segelvorbereitungen, aber im Hinterkopf dachte ich weiter an Roberts Konzept der Vergebung. Verflucht, ich war katholisch erzogen worden, Schuld, das Geschenk, an dem man sein Leben lang Freude hat . Konnte ich mir wirklich vergeben? Um zu leben, das wusste ich, müsste ich das. Ich musste mir immer wieder sagen, dass es nicht meine Schuld war, sondern Schicksal, was auch immer das bedeutete. Ich wusste auch, dass ich mich beruhigen musste, Vernunft walten lassen sollte und, egal, wie müde oder kaputt ich war, ich musste alles sorgfältig durchdenken. Ich musste das Ego loslassen und mir zu Herzen nehmen, dass ich nicht so gewitzt, schnell oder vorsichtig war. Ich glaubte, was Robert andeutete, war in der Gegenwart zu bleiben und einen Tag nach dem anderen zu leben, Stunde für Stunde. Ich versuchte nicht so viel Energie an meine Zukunft zu verschwenden oder über das nachzudenken, was immer offensichtlicher wurde. Ich konzentrierte mich auf das eine Wort, das die Staatsflagge von Rhode Island zierte: Hoffnung.
Sobald wir unterwegs waren, fing ich an runterzukommen und stürzte mich in Routine. Robert opferte etwas Zeit, um die Grundlagen des Segelns mit mir durchzugehen, mal wieder. Ich übte auch Knoten zu knüpfen und hielt die Augen offen wegen anderer Boote.
Tenants Harbor war eine typische Küstenstadt Neuenglands und ein großartiger Ort, um den Sommerurlaub dort zu verbringen. Zu segeln, Golf zu spielen, ein paar Galerien zu besuchen und eine Menge Meeresfrüchte zu essen. Nun wimmelte es dort vor Untoten. Unter vollen Segeln ging unsere Ankunft nicht unbemerkt vonstatten. Sie strömten rasch zum Ufer und bevölkerten die Docks, kletterten übereinander und schubsten die Vordersten ins Wasser, nur um einen Blick auf uns zu erhaschen. Sie streckten die Arme und Fingerspitzen so weit wie möglich nach vorne, die Augen fast flehend. Da waren Hunderte von ihnen und es wurden immer mehr. Die Menge erzeugte ein kollektives Brüllen, als wir näherkamen. Ich hatte noch nie so viele auf einmal gesehen und schauderte bei dem Gedanken daran, wie es wohl gerade in Portsmouth oder Boston aussah. Der Wind drehte und der Gestank war unglaublich.
In der Menge fiel mir eine Person besonders auf. Sie war groß, blond und wäre lebendig schön genug für das Cover eines Bademodenmagazins gewesen. Sie trug die Überreste von etwas, das wie ein Hochzeitskleid aussah, schmutzig und zerrissen. Mit einer nackten Brust und auf High Heels herumstolpernd gab sie ein zugleich erotisches als auch deprimierendes Bild ab. Es durchfuhr mein Gehirn und mir wurde klar, dass ich wohl nie wieder Sex haben würde. Ich versuchte an das letzte Mal zu denken, vor ein paar Jahren. Ich konnte mich beim besten Willen nicht an ihr Gesicht erinnern.
Robert und ich hatten uns auf einen sorgfältig geplanten Ablauf geeinigt, wie wir ein Boot betreten wollten. Zuerst stellte er die Sirene an, um unsere Anwesenheit zu verkünden. Dann funkten wir das Schiff an, um zu sehen, ob jemand Lebendiges an Bord war. Bewaffnet und bereit loszulegen, umkreisten wir anschließend das Gefährt und checkten es aus allen Blickwinkeln. Sobald es aussah, als wäre die Luft rein, fuhren wir ran, ich sprang rüber, die Flinte in der Hand, und Robert entfernte sich. Der Plan war, dass ich, falls ich auf etwas stieß, womit ich nicht klarkam, ins Wasser springen und zu ihm schwimmen würde. Sobald alles sicher aussah, gab ich ihm Bescheid ranzufahren und anzulegen. Wir machten anfangs eine Menge Lärm, um jegliche Kreaturen im Inneren aufzuscheuchen, warteten dann und lauschten. Abgeschlossene Türen waren immer am schlimmsten und ich feuerte ein paar Mal, um sie zu öffnen. Man wusste einfach nicht, was vielleicht herausstürmte oder einfach wartend dasaß. Sobald das Boot geräumt war, gingen wir einkaufen.
Die Raubzüge waren ein voller Erfolg. Wir fanden eine Menge Benzin, Batterien, Essen, Wasser und Dewars Scotch. Wir deckten uns auch mit nicht so Lebensnotwendigem ein, wie Leuchtgeschossen, Kleidung, Büchern, Hygieneartikeln und überhaupt allem, was wir für brauchbar hielten. Da wir nur zu zweit waren, war Platz überhaupt kein Thema. Wir trafen nur auf zwei Zombies, beide waren schnell erledigt. Sie stolperten auf einer großen Jacht herum, auf der wir ein spätes Frühstück genossen, duschten und eine weitere Schrotflinte und Munition einsackten. Es gab noch mehr Boote zu durchsuchen, aber wir hatten reichlich gebunkert und waren bereit, weiterzuziehen. Robert hielt es für eine gute Idee, sobald wir eine einigermaßen dauerhafte Bleibe gefunden hätten, eine Datenbank anzulegen mit all den Booten und Orten, die wir inspiziert hatten, was wir entfernt hatten und was zurückgeblieben war. Eine tolle Idee, aber ohne Strom und der Seltenheit von Batterien müssten wir das per Hand tun. Soviel zu dem Excel-Auffrischungskurs, den ich im letzten Semester belegt hatte.
Als wir uns aus dem Hafen manövrierten, erschien ein weiteres Segelboot in der Ferne auf dem Weg nach Norden. Robert feuerte ein Leuchtgeschoss ab, aber es drehte ab. Da der Kurs nach Norden nicht unseren Plänen entsprach, fuhren wir nicht hinterher, sondern zogen gen Süden nach Monhegan Island.
Wenn ich nicht gerade Robert zuhörte oder mit einer Schnur spielte (wegen der Knoten), überwachte ich das Radio und suchte verschiedene Frequenzen ab. Es war überraschenderweise viel los. Da gab es französisch sprechende Gruppen aus Nova Scotia, eine Handvoll aus dem ländlichen Maine und einige New-Hampshire-Gemeinden, die noch dabei waren. Das Notfallalarmsystem funktionierte auch, obwohl sie immer noch den gleichen Kram wie letzte Woche verkündeten: Drinnen bleiben und die Anweisungen der Behörden befolgen.
Wir hatten auch Verbindung zu anderen Booten. Im Großen und Ganzen hieß es, wenn man sich im ländlichen Raum befand und wachsam blieb, bestand eine Chance, war man irgendwo in der Nähe eines Bevölkerungszentrums, war man am Arsch. Niemand hatte wirklich aktuelle Informationen und jeder erzählte die gleiche Geschichte, dass alles viel schneller passierte als erwartet. Einige hofften sogar auf Rettung, in dem Glauben, dass es noch eine Regierung gab, dass es jemanden kümmerte und jemand sie retten würde. Manche der Gruppen, mit denen wir sprachen, hatten Kurzwellenkontakt mit Europa und der Karibik, aber die waren in der gleichen Situation wie die USA – am Arsch. Wir schnappten auch Gerüchte auf, über Marineaktivitäten südlich von uns und über etwas, das auf Martha's Vineyard und in Nantucket vor sich ging. Jede Gruppe hatte ihre eigene Vorstellung davon, sich zu retten. Wie wir zogen manche in den Süden, manche nach Norden; nutze die Kälte und friere die Scheißer ein , andere hielten still und rührten sich nicht vom Fleck. Zwei der Gemeinden im Süden von Maine gingen nirgendwo hin, sie standen unter Belagerung.
Читать дальше