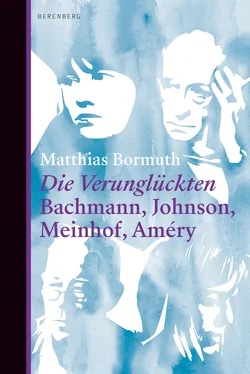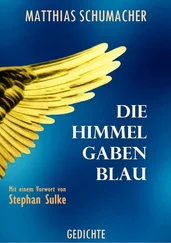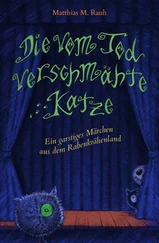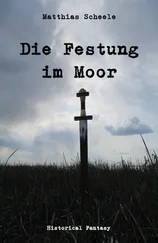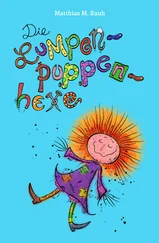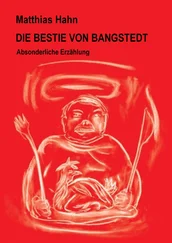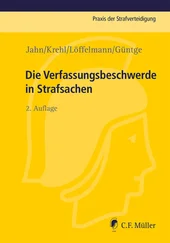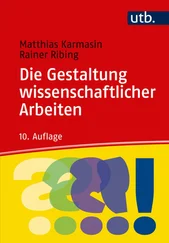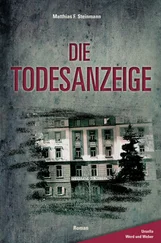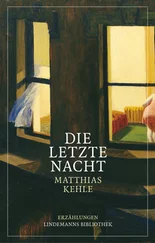In ganz anderer Deutlichkeit entfaltet der katholisch erzogene Jean Améry zwei Jahre nach Meinhofs Tod in dem Essay Mein Judentum säkularisierte Gedanken einer jüdisch-christlichen Passionsfigur: »Der Jude war das Opfertier. Er hatte den Kelch zu trinken – bis zum allerbittersten Ende. Ich trank. Und dies wurde mein Judesein. Das Juden tum war eine andere Sache. Mit ihm hatte ich nichts zu tun.« Die Erfahrung des Holocaust wird ihn im Herbst 1978 einholen. Jean Améry nimmt sich in Salzburg das Leben und wird zur modernen Passionsfigur wider Willen.
Auch Uwe Johnson exponiert in seinen Jahrestagen das Passionsmotiv. Gesine Cresspahl leuchtet dessen religiöse Erklärung im protestantischen Konfirmationsunterricht nicht ein. Johnsons Heldin lehnt Tod und Sühne als dogmatisches Modell ab, das helfen soll, mit der Geschichte fertig zu werden. Dagegen hält Gesine es strikt mit der aufklärerischen Notwendigkeit, »mit Kenntnis zu leben«. Ihre übergewissenhafte Mutter dagegen, die schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hat, wählt in der Nacht vom 9. November 1938 in einer Scheune den Verbrennungstod, nachdem ein jüdisches Mädchen erschlagen worden war. Johnson lässt es offen, ob ihr Tod Ausdruck eines irregeleiteten Gewissens oder vielmehr, wie der Pastor es will, als politisch bewegtes Selbstopfer zu sehen ist, das zugleich eine aktive Sühne im Sinne Jesu bedeute. Vor Abschluss der Jahrestage ließ Johnson in der autobiographischen Skizze eines Verunglückten sein Alter Ego den Selbstmord vergeblich suchen. Nur ein »Ableben« war dem Protagonisten möglich, das vor allem der quälenden Erinnerung an das persönliche Unglück geschuldet war, in das ihn das Eheleben nach Jahren vermeintlichen Glücks gestürzt hatte. Johnson selbst starb drei Jahre später, als das große Epos endlich beendet war, an den Folgen des jahrelangen Alkoholexzesses, dem er sich in der Einsamkeit der englischen Jahre hingegeben hatte. Das suizidale Denken, das im Werk in vielfachen Nuancierungen anklang, holte Johnson in dieser protrahierten Form der Selbstzerstörung endgültig ein.
Auch bei Ingeborg Bachmann ist im schriftstellerischen Bewusstsein der Holocaust präsent. In ihrem Hauptwerk Malina quälen das »Ich« schreckliche Träume vom Tod in den Gaskammern. Bachmann imaginiert das Schicksal des Verbrennungstods in dem Roman sowie in einer anderen Erzählung. Tatsächlich erlag die Dichterin im Oktober 1973 den Verbrennungen, die sie sich in einem narkotischen Zustand nach Tablettenmissbrauch zugezogen hatte. Seit einem frühen Essay über Simone Weil war die Figur des Heiligen, der dem Unglück der Wirklichkeit mit der Konsequenz seines tödlichen Martyriums begegnet, in ihrem Werk präsent, auch wenn Bachmann selbst das Lebensglück durchaus zu genießen wußte. Die Freundschaft zu Hans Magnus Enzensberger blieb bis zuletzt ungebrochen, gerade weil Bachmann unter anderem darauf verzichtete, von den »vielen Liebhaber[n]« zu berichten, »die sie ertrug«, so der Autor in seiner späten »Vignette«. Dabei habe sie »von ihren Fluchten, ihren Depressionen und von den langen Monaten, die sie in Kliniken und Sanatorien zugebracht hatte, […] hie und da etwas durchblicken« lassen.
Die folgenden Persönlichkeitsprofile geben in allen Fällen suizidale Züge zu erkennen, die erlauben, von säkularisierten Passionsgeschichten zu sprechen. Mit dem deutsch-jüdischen Literaturhistoriker Erich Auerbach, einem Freund Walter Benjamins, lässt sich der untergründige Zusammenhang zwischen der Religionshistorie und der modernen Literatur genauer verstehen. Nicht zufällig erinnerte sich der Romanist, den man 1936 von seinem Marburger Lehrstuhl vertrieben hatte, im türkischen Exil an die alttestamentlichen Wurzeln des Passionsgedankens, den er in seinem Buch Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur über dessen christliche Überformung bis in die moderne Gestalt bei Virginia Woolf verfolgt hatte. Dass diese Sicht sich dem Geist der Hegel-Zeit verdankt, in der die große Wende von der christlichen zur säkularen Deutung der Wirklichkeit statthatte, dessen ist sich Auerbach bewusst. Zugleich geht mit seiner Genealogie die Einsicht in die jüdischen Wurzeln des Rätsels des Lebensopfers einher: die Opferung des Isaak. Die menschliche Vernunft kann diesen Gedanken nicht fassen; jedem Opfer wohnt bei aller Konsequenz etwas Absurdes inne, als ob der Tod wirklich der Ursprung der Versöhnung sein könnte, wie es das Christentum propagiert.
Auerbach löst das Geheimnis keineswegs, aber seine Erinnerung an die jüdisch-christlichen Wurzeln der Passion in ihren vielfältigen Aporien erlaubt, die Schreibmotive der modernen Autoren in ihren suizidalen Gedanken und Handlungen besser nachzuvollziehen. Wo die Autorität der Religion schwindet, müssen menschliche Visionen versuchen, das Leiden als eine Kategorie des Lebens in dessen »Grenzsituationen« zu verstehen, um mit Karl Jaspers zu sprechen. Insofern kommen in den vier Fallstudien auch psychopathologische und kulturphilosophische Einsichten zum Tragen, um Werk und Leben der Autoren im biographischen und historischen Bedingungsgefüge genauer erhellen zu können.
Was jenseits aller Details sichtbar werden kann, sind jeweils eigentümliche Strukturen, in denen das eigene und allgemeine Unglück erlebt wird. In allen Fällen fehlt der befreiende Ausgang ins Leben, den Hans Magnus Enzensberger bis heute virtuos beherrscht. Mit einem Zitat aus Ingeborg Bachmanns Gedicht »Die gestundete Zeit« verteidigt er »Überlebenskünstler«, die mit Leichtigkeit und Wendigkeit begnadet sind: »Sind Anpassung, glückliche Zufälle, Kompromisse und mehrdeutige Entscheidungen von vorgestern? Kann man nichts von ihnen lernen? ›Es kommen härtere Tage‹«. Enzensberger ist eine solch glücklichere Natur, die sich aber auch ein feines Gespür für jene »Spätfolgen der Traumata« bewahrt hat, welche etwa Jean Améry, Paul Celan und Primo Levi in den Freitod getrieben haben. Die hier behandelten Werke und Lebensgeschichten zeugen auch von dem vergeblichen Bemühen Bachmanns, Johnsons und Meinhofs, der inneren Verzweiflung angesichts der historischen Katastrophe zu entkommen.
In allen Skizzen wird man, um an Franz Kafka zu erinnern, mit dem Unglück des Lebens vertraut, das zwar ästhetisch zu lindern, aber nicht zu überwinden ist. Gleichwohl bleibt auch die andere Seite des leidenschaftlichen Interesses an den Schriftstellern und ihren Lebensläufen wahr, die Uwe Johnson einmal wunderbar formulierte: »Er fand es regelmäßig lehrreich, eine Person anzusehen auf ihre Entstehung, hinter der Person ihr Leben zu finden. Es machte Spaß, einer bewußten Vergangenheit die tatsächliche zu finden, die Erinnerung einer Person mitzunehmen zurück ins Vergessene, auch sie überrascht zu sehen vor sich selbst.«
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.