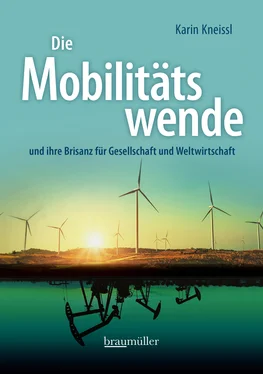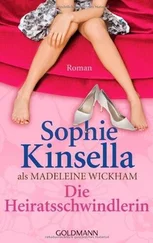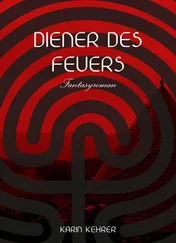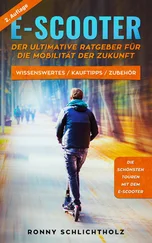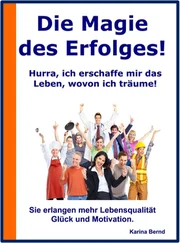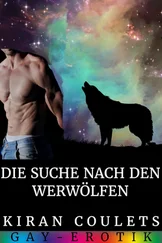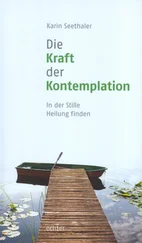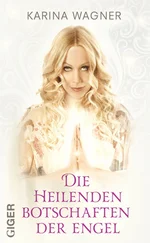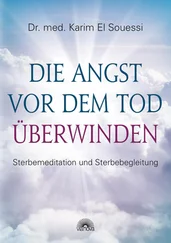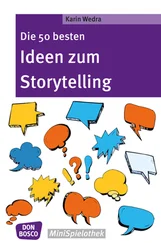Dank chinesischer Investitionen haben sich viele Gesellschaften auf diesem Kontinent aus der extremen Armut hochgearbeitet. Hightech wird heute in Rwanda, dem nicht unumstrittenen Vorzeigeland, in Uganda und Tansania produziert. Ob es nun TV-Geräte oder Computer sind, das Auto der Zukunft wird nicht ein Benziner mit Bordcomputer sein. Vielmehr lautet der Anspruch der Chinesen wie auch der US-Amerikaner gleichermaßen, Autos in rollende Computer zu verwandeln. Ähnlich wie das Smartphone werden diese Geräte dann durch Aktualisierung der Software verbessert.
Dass der afrikanische Markt für Autobauer interessant sein muss, lässt sich mit folgenden drei Argumenten illustrieren:
a. Der afrikanische Markt ist am wenigsten erschlossen, hier werden Autos sowohl im städtischen Nahverkehr mangels öffentlichen Transports wie auch v. a. für das Land benötigt.
b. Die Bevölkerungspyramide spricht für eine wachsende Nachfrage von Autofahrern in den kommenden Jahrzehnten, während Europa und auch China vergreisen, nicht anders als Japan, wo mehr Windeln für die Altenpflege als für Babys produziert werden.
c. Die Rohstoffe für die zukünftigen Antriebstechniken finden sich eher im rohstoffreichen Afrika als im rohstoffarmen Europa, das einst mit dem technischen Vorsprung punkten konnte. Dieser Vorsprung ging jedenfalls in der Autoindustrie verloren.
Meines Erachtens ist noch unklar, ob das Elektroauto die entscheidende Antwort sein wird oder ob im Zuge eines notwendigen offenen Forschens doch noch andere Antriebe oder völlig neue Fortbewegungsformen kommerziell entwickelt werden. Für den Stadtverkehr und gewisse Mittelstrecken soll die E-Mobilität die Zukunft weisen, dann aber für viele Umweltbewusste doch eher als elektrisches Fahrrad. In so manchem Konzern und vor allem auf Ebene der Europäischen Kommission versteift man sich auf das Elektroauto, was wiederum von der chinesischen Nachfrage der letzten Jahrzehnte angetrieben wird. Die Europäer folgten auch hier den Chinesen und nicht umgekehrt.
Forschungskooperationen betreiben chinesische Firmen trotz politischer Autokratie um vieles offener, intensiver und jedenfalls konsequenter als dies selbst innerhalb der EU der Fall ist. Zudem kehren die Absolventen von internationalen Universitäten seit bald 15 Jahren wieder nach China heim und stehen nicht mehr – wie einst – jenen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, wo sie ihren Abschluss gemacht haben. Es spricht grundsätzlich vieles für eine chinesische Technologieführerschaft, die mit den Möglichkeiten der afrikanischen Partner eine neue Lieferkette für zukünftigen Automobilbau ermöglicht. Das sogenannte Baukastensystem, wonach wesentliche Bestandteile für die Marken eines Konzerns gemeinsam produziert werden, wird bei zukünftigen Flotten von Elektroautos noch mehr zum Einsatz kommen. Allein die neuen Möglichkeiten des dreidimensionalen Druckens von Bestandteilen werden ihren Anteil am Aufbau von Lieferketten in Subsahara-Afrika haben. Volkswagen und Renault sind bereits seit Jahren in einigen afrikanischen Staaten vertreten. Ein chinesischer Mittelklassewagen oder Kompakt-Van könnte zu einem sehr wettbewerbsfähigen, i. e. niedrigen Preis in Rwanda oder anderswo in der Seenregion Ostafrikas gebaut und vertrieben werden. Die Betriebsstätten in Europa hätten dann das Nachsehen, dies würde Deutschland ebenso wie Frankreich und deren nach Ost- und Mitteleuropa ausgelagerte Zulieferer sehr hart treffen. Die letzte in Europa verbliebene Schlüsselindustrie wäre nach den Zäsuren der letzten Jahrzehnte definitiv Geschichte. Es blieben dann Automobilmuseen mit interaktiven Schauräumen, um sich vorzustellen, wie Autos einst in Turin, Stuttgart oder in Paris hergestellt wurden. Zudem wären mit einem Schlag Millionen Arbeitsplätze in Europa weg.
Neugieriges Staunen, manchmal auch eine Prise Arroganz oder Unverständnis, schlägt mir entgegen, wenn ich diese These durchargumentiere. Das erklärt sich wohl aus dem immer noch vorherrschenden mitleidigen Blick auf den sogenannten Süden. Die Lieferketten werden sich aus vielen weiteren Gründen auf dem afrikanischen Kontinent neu gestalten. Dazu gehören der Durst nach Veränderung junger Generationen wie auch die zunehmend verbesserten Arbeitsbedingungen in Staaten, wie Rwanda und Sierra Leone, wo zudem Menschen in Führungspositionen tätig sind, die Genozide, Kriegsmassaker und vieles mehr überlebt haben, die menschlich einfach beeindruckend sind. Nordamerikanische und europäische Firmen werden manches heimholen, um vermeintlich Arbeitsplätze zu sichern, doch Robotik und Digitalisierung werden kaum einen solchen Schub für den Arbeitsmarkt, egal ob für Fachkräfte oder Logistiker, zulassen. Besonders werden diese Transformationen in der Autowirtschaft die Zulieferer zu spüren bekommen.
Österreich und der Wandel vom Wegbereiter zum Zulieferer
Auch in Österreich muss man die Museen besuchen, um eine Ahnung einstiger Größe zu erheischen. Das gilt nicht nur für die kaiserlichen Sammlungen von Juwelen und Kunstwerken, oft Geschenke der jeweiligen zeitgenössischen Potentaten, welche die Republik in den Bundesmuseen beherbergt. Besonders spürbar wird der Wandel der letzten 120 Jahre in den technischen Sammlungen. Fest eingegraben in meinen Erinnerungen aus Kindertagen der frühen 1970er-Jahre ist mein Staunen beim Betrachten des „Marcus-Wagens“ im Technischen Museum Wien. Dieses Gerät aus Holz und Eisen mit seinen Kutschenrädern wurde als das älteste Automobil der Welt vorgestellt. Siegfried Marcus (1831 bis 1898) war aus Mecklenburg nach Wien gekommen, wo er zunächst telegrafische Apparate entwickelte und sich dann dem Motorenbau immer mehr zuwandte. Sein irrtümlich auf 1877 datiertes Auto wurde später, jedenfalls nicht vor 1888 geschaffen. Marcus experimentierte zeitgleich wie andere Pioniere an einem Automobil mit Explosionsmotor. Mir sollte der „Marcus-Wagen“ nicht mehr aus dem Sinn gehen. Für Automuseen entwickelte ich jedenfalls ein Faible, denn die dort ausgestellten Exponate haben einfach Charakter und lassen träumen, v. a. ist es sympathisch, wenn man das eine oder andere Modell gar noch selbst erlebt hat.
Beim Besuch des weitläufigen Motorradmuseums in Vorchdorf in Oberösterreich zogen nicht nur die vielen exquisiten Exponate mein Interesse an; fast noch mehr faszinierten mich die Informationstafeln über hunderte Motorradfirmen, die in der Zwischenkriegszeit in Wien die Zweiradindustrie beflügelten. Welcher Erfindergeist und v. a. welche unternehmerische und technische Vielfalt hatten in dieser Branche einst bestanden? Bis in die 1990er-Jahre existierte mit den Steyr-Daimler-Puch-Werken ein Unternehmen, das zwar infolge staatlichen Missmanagements sehr herabgewirtschaftet war, aber als Marke aufgrund der Qualität seiner Produkte, der Vielfalt an Patenten und der Treue seiner Kunden in sich ein Wert war. Die Palette reichte von Pkw über Autobusse zu Lkw und geländegängigen Traktoren. Der von Porsche entwickelte Steyr XII galt als einer der besten Bergwagen; der Steyr 50 war der Vorläufer des deutschen Volkswagens. Die Motorräder von Puch, wie die legendäre Puch 250, waren besonders populär. Einer meiner ersten Beiträge für das Wirtschaftsressort der deutschen Tageszeitung „Die Welt“, für die ich damals als freie Korrespondentin zu arbeiten begonnen hatte, war die Auflösung der Steyr-Werke im Frühjahr 1999; eine Reihe von Ausgliederungen war bereits erfolgt. Der austrokanadische Unternehmer Frank Stronach hatte gleichsam ein Schnäppchen mit dem Erwerb einzelner Unternehmensanteile, von Immobilien und Lizenzen, gemacht. Die verbleibende Steyr-Daimler-Puch-Fahrzeugtechnik in Graz wurde mit der Firma Magna verschmolzen, die bis heute ein wichtiger Zulieferbetrieb für die deutsche Autoindustrie ist. Für mich war das Interview mit einem der letzten Manager im Steyr-Gebäude auf dem Schwarzenbergplatz in Wien vor dessen Abriss eine düstere, aber zugleich bezeichnende Erfahrung, wie in Österreich Geschäfte gemacht werden. Mangelnde Transparenz, unklare Anbote und in sich geschlossene Zirkel erlebte ich damals in Wien. Ingenieure, die für ihr Unternehmen lebten, mit Begeisterung forschten und an neuen Antrieben tüftelten, durfte ich noch in Steyr antreffen. Eine gewachsene Struktur, die einst die tüchtige Familie Werndl in Steyr im 19. Jahrhundert aufgebaut hatte, wurde zur Jahrtausendwende endgültig zerschlagen. Ich erlaube mir diesen Exkurs aus folgendem Grund:
Читать дальше