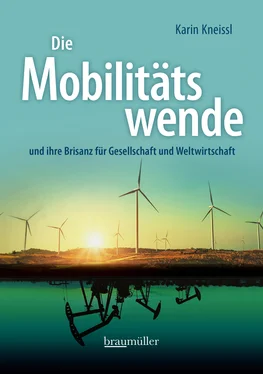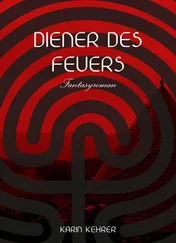Die Pandemie, die ihren Ausgang in der chinesischen Provinz Hubei nahm, die auch Heimat wichtiger Betriebsstätten für die internationale Automobilindustrie ist, hat ein wesentliches Problem neu aufgedeckt: die Verwundbarkeit unserer global verteilten Lieferketten mit ihren jeweiligen Prozessen. Es ist nicht das erste Mal, dass über „Backshoring“, also das Heimholen von Produktionsstätten, laut nachgedacht wird. Die Rückübersiedlung der Manufaktur der Steiff-Teddybären von China nach Deutschland vor über zehn Jahren machte keine Schlagzeilen, ist aber ein interessantes Lehrbeispiel. Ausschlaggebend war, das Vertrauen der Kunden wiederzugewinnen, da diese bereit waren, für Qualität „made in Germany“ zu zahlen. Auch Apple eröffnete unter Applaus der US-Regierung im Jahr 2019 eine wichtige Produktionsstätte erstmals wieder in den USA. Die Globalisierung nahm ihren Anfang mit dem Containerverkehr in den 1960ern und bestimmte fortan die Weltwirtschaft dank liberalisiertem Zahlungsverkehr sowie neuer Kommunikation. Seither sprechen wir von globalen Lieferketten, die Kosteneffizienz bei Löhnen, Infrastruktur und Rohstoffen folgte.
Auslöser für das Überdenken und teils Neugestalten von Lieferketten waren nicht erst der Ausbruch eines Vulkans auf Island im Frühjahr 2010, die steigenden Lohnkosten in asiatischen Betrieben sowie Probleme im Qualitätsmanagement (v.a. bei Spielzeug und IT-Produkten), sondern auch wachsende Sorgen um Unterbrechungen im Frachtverkehr infolge von Unruhen, Streiks und eben Naturereignissen. Anstelle einer zerbrechlichen „Just-in-time-Delivery“ wächst seit Jahren der Wunsch nach Überschaubarkeit wichtiger Versorgungsketten. Die Covid-Krise führte nur neuerlich vor, was vielen zumindest während des Stillstands des Flugverkehrs infolge eines Vulkanausbruchs auf Island bereits klar war: Als Firma, die von Ausfällen wichtiger Komponenten für die Herstellung einer global produzierten Ware betroffen ist, sollte man in Lagerhaltung und alternative Lieferanten im Falle der „Force majeure“ investieren. Ob diese Pandemie nun den erforderlichen Schub in eine neue Organisation von Lieferketten ermöglicht? Damit einher geht auch die Debatte, ob die Globalisierung gar rückabzuwickeln ist. Deglobalisierung wird nicht nur in akademischen Kreisen, sondern auch in großen Beratungsunternehmen diskutiert; zuvor war dies schon mit Blick auf mögliche Handelskriege der Fall. Rund um den Brexit haben wir in den restlichen EU-Staaten die Umorientierung von Lieferketten mehrfach diskutiert. Der Brexit, voraussichtlich ohne Abkommen zwischen London und Brüssel, wird zu meistern sein. Viel komplizierter wird der Umgang der EU, Europas insgesamt sowie der restlichen Welt mit China. Im Verhältnis Europa zu Asien, vor allem eben zur Volksrepublik China, hat sich im Automobilsektor eine starke Verquickung ergeben. Rund 60 Prozent des Umsatzes der deutschen Automobilindustrie erfolgt in China; entsprechend hart war daher dieser Sektor bereits zu Jahresanfang getroffen, als die Probleme nur in der Provinz Hubei bestanden.
Die Regierung in Peking hatte die chinesischen Unternehmen Ende der 1990er-Jahre aufgerufen, ins Ausland zu expandieren. Ein Grund war, die angehäuften Devisenreserven einzusetzen, und so an westliches Know-how über den Erwerb von Firmenanteilen zu gelangen. „Zou chu qu“ hieß die Strategie auf Chinesisch. Das bedeutet so viel wie „Ausschwärmen“. Im Jahr 2016 investierten chinesische Unternehmen in Europa fünfmal so viel wie europäische Firmen in China. Es ging bei dieser Einkaufstour oft um wahllose Einkäufe, wie Perlen an einer Kette. Diese Metapher der Perlenkette kommt auf chinesischer Seite oft vor, man denke nur an die Seeroute neben der Landroute, der Seidenstraße-Initiative. Diese Verbindung zwischen wichtigen Häfen vom Pazifik bis zum Mittelmeer wird auch mit einer Perlenkette verglichen. Erst in letzter Zeit ist eine klarere Strategie erkennbar. Zudem verschärfte Peking die Kapitalverkehrskontrollen Ende 2016, um den Kapitalabfluss zu unterbinden, und beendete so die Einkaufstour. Indes ist aber der deutsche Automobilhersteller Daimler noch chinesischer geworden. Die Beijing Automotive Group BAIC, ein Staatskonzern, und der Hersteller Geely halten gemeinsam 15 Prozent. BMW und Volkswagen sind mit chinesischen Partnern schon länger intensiv verbunden. Die Abhängigkeit des deutschen Automarkts von China ist umfassend. Etwa jedes dritte Auto, das BMW, Volkswagen und Daimler 2018 verkauften, ging an chinesische Käufer. Vier von zehn Autos setzt Volkswagen in China um, der Marktanteil beträgt fast 20 Prozent. Bereits seit 1984 betreibt Volkswagen ein Joint Venture mit dem staatlichen Autohersteller, der Shanghai Automotive Industry Corporation.
Über Lieferketten und industrielle Prozesse wird weltweit intensiv nachgedacht. Ob die enge Verquickung zwischen chinesischen Anteilseignern und deutschen Autokonzernen verringert oder gar rückabgewickelt werden kann, darf bezweifelt werden. Vielmehr sind neue Lieferketten im Entstehen, wo europäische Konzerne das Nachsehen haben könnten. Noch lange bevor die chinesische Expansionsstrategie im Sinne eines „Go West“ nach Zentralasien und über den rohstoffreichen Nahen Osten in Richtung europäischer Absatzmarkt ging, erfolgte das chinesische „Ausschwärmen“ auf den afrikanischen Kontinent. Ging es anfänglich um Bergbaukonzessionen, ob Kupferminen in Sambia oder Erdölfelder im Sudan, folgten bald landwirtschaftliche Investitionen. Die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung steht in China hoch oben auf der nationalen Agenda und des Konzepts der Globalisierung mit chinesischen Zügen, wie sie Präsident Xi Jinping in seinen Reden seit 2017 gerne beschreibt. Indes haben sich chinesische Staatskonzerne und Privatunternehmer gleichermaßen als Champions von Algerien bis Südafrika etabliert. Die nächsten entscheidenden Lieferketten einer Weltwirtschaft, die auch mit Pandemien umgehen muss, werden meines Erachtens hier entstehen.
Automobilproduktion auf dem afrikanischen Kontinent
Seit einigen Jahren bediene ich gerne folgenden Vergleich, der mir während eines Arbeitsaufenthalts in Angola angesichts der massiven chinesischen Präsenz durch den Kopf ging: So wie auf dem iPhone steht „Designed in California, assembled in China“, könnte auf dem Auto der Zukunft die Inschrift lauten: „Designed in China, assembled in Africa“. Die neue Werkbank der Welt ist im vergangenen Jahrzehnt südlich der Sahara entstanden. Wesentlich hierfür waren und sind asiatische Investoren, wobei indische und arabische Händler traditionell im Osten und Süden des Kontinents seit Jahrhunderten verankert sind. Die umtriebigen chinesischen Investoren, die politisch schlau stets auf die Schicksalsgemeinschaft der einstigen von Kolonialmächten ausgebeuteten Entwicklungsländer pochten, waren bald überall auf dem Kontinent unterwegs. Sieben Tage die Woche, das gesamte Jahr über waren und sind chinesische Arbeiter und Angestellte unterwegs – ohne die Sonderprivilegien westlicher „Expats“, wie die von ihren Firmen mit wohldotierten Sonderverträgen entsandten Arbeitnehmer heißen. Aus Billigproduktion wurde Hightech und afrikanische Partner waren darin bald eingebunden. Nun lässt sich trefflich streiten, ob die afrikanischen Völker von einer Art chinesischer Kolonialisierung überrollt werden, oder ob China schon viel früher als alle anderen auf „Handel zwischen Partnern“ umgeschwenkt ist. Tatsache ist, dass die EU erst 2016 – und dies wieder einmal unter dem Titel Migration – begriff, wie geografisch nahe dieser Kontinent liegt. Seither wird die Liste der EU-Afrika-Foren unter dem Titel „Lasst uns Handel treiben“ immer dichter. Aus dem gönnerischen Ansatz der Entwicklungshilfe soll nun endlich mit unverzeihlicher Verspätung ein ebenbürtiges Miteinander im Sinne von Geschäftsinteressen werden. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass wir Europäer, von einigen Ausnahmen abgesehen, viel zu spät und zu halbherzig umdenken. Zwar gibt es genug afrikanische Unternehmer und noch viel mehr besonders tüchtige Geschäftsfrauen, die einer chinesischen Zwangsumarmung gerne entkommen möchten und nach alternativen Kunden suchen. Doch für europäische Unternehmer stellt sich neben den vielen rechtlichen Auflagen die Hürde, überhaupt Geschäfte anzubahnen. Großkonzerne, die Briten, Franzosen oder auch Portugiesen mit Expertise und Geschäftskontakten anstellen, konnten bislang die größeren Aufträge v. a. afrikanischer Regierungen erhalten. Zudem haben sich türkische Unternehmen in den letzten 20 Jahren u. a. im Servicesektor klug etabliert. Traditionell erfolgreich war immer schon die libanesische Diaspora, deren Vertreter zu so manchem Vermögen, v. a. im frankophonen Westafrika, gelangten.
Читать дальше