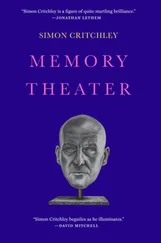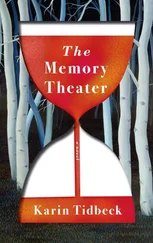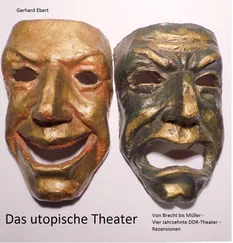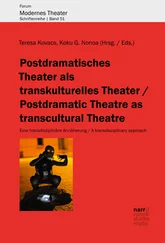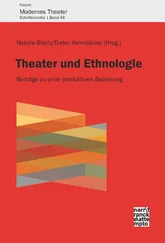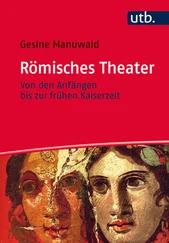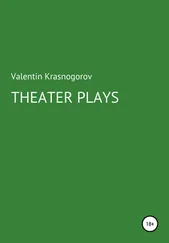Eva Behrendt bezeichnet in ihrem Aufsatz „Politische Performances zwischen Irritation und Aufklärung“ die Aktion 18, „tötet Politik!“ als einen Klassiker der politischen Performance und betont, dass diesem im Kontrast zum klassischen Theater keine dramatische Textvorlage für die theatrale Aufführung im Sinne von Schauspiel zugrunde liegt. In Analogie zum religiösen Ritual merkt sie an, dass die Handlung, die vom Darsteller – in diesem Fall Schlingensief – performiert wird, mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Behrendt konzentriert ihre Argumentation auf das zehnminütige Voodoo-Ritual vor Möllemanns Firma Web/Tech. Außerdem erinnert dies an eine von Joseph Beuys in einer New Yorker Galerie abgehaltene Coyote Performance I like America, and America likes me (1974), die aber mehr als eine esoterische Kunstübung gewesen sei: Behrendt zufolge sei die Performance ein politisches Statement von Beuys gewesen, da er sich mit dem Kojoten so beschäftigt habe, dass eine Verbindung mit Amerikas Ureinwohner_innen versinnbildlicht wurde. Ähnlich habe Schlingensief, so Behrendt, Bezug auf die parteipolitische Realität der Bundesrepublik genommen, indem auch antisemitisch konnotierte Vorgänge wie die Bücherverbrennung aufgegriffen wurden. Solche fast tagesaktuelle Unmittelbarkeit und die Treffsicherheit, mit der Schlingensief anhand seiner Performances in die Schlagzeilen geraten ist, ist nach Behrendt derzeit im Bereich des deutschsprachigen Theaters unerreicht, obschon heute immer noch politisches Theater und politische Performancekunst bestehen.7
Nitsch und Schlingensief zeichnen sich durch ihre verwandten künstlerischen Störpraktiken und ihre jeweiligen tabubrechenden Theateransätze aus. Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von den erwähnten Studien. Das Orgien-Mysterien-Theater und die Aktion 18, „tötet Politik!“ werden dann als zwei Beispiele von Theater als Ästhetik und Bereich des kulturellen Synkretismus bzw. des postdramatischen Theatersynkretismus8 veranschaulicht, in dem verschiedene Interferenzelemente bestehen. Außerdem fungieren sie als Theateraktionen, die kulturelle Selbstveränderungen durch die Hereinnahme des Fremden katalysieren. Somit ermöglichen beide Theateraktionen einen verkehrten, transkulturellen bzw. synkretistischen Blick auf die jeweils kulturspezifischen Theater- oder Rollendarstellungsformen, die über das Eigene weit hinausgehen und stark auf das Fremde (im Eigenen) verweisen. Denn mit der Konzeptualisierung des postdramatischen Theaters als reale Erfahrung von Zeit, Raum, Körper rücken im Zeitalter der weltweiten Migrationsbewegungen die Fremdheitserfahrungen gravierend vorwärts. Dabei geht die Fremdheitserfahrung nicht nur von Fremden (z.B. Ausländer_innen, Migrant_innen) bzw. von sogenannten Flüchtlingen aus, sondern auch von dem durch Vergeistigung und Zivilisationsprozesse verdrängten Fremden im Eigenen: z.B. von den blutigen Opferritualen. Aus dieser komplexen Konstellation des Fremden, das im Eigenen verwurzelt ist, soll das Fremde nicht mehr bzw. nicht nur in den fernen Kulturen, sondern (auch) im Inneren des synkretistischen sowie unterdrückten Eigenen gesucht werden. Anders formuliert: Zeichnet sich die gegenwärtige Kulturauffassung durch vielfältige kulturelle Interferenzelemente aus und distanziert sie sich folglich von einem Containermodell der Kultur, so ist die Suche nach dem, „was als kulturell fremd gilt, nicht mehr unbedingt an einen fremden Ort gebunden“9, sondern bei sich im Eigenen auffindbar. Der transkulturelle bzw. synkretistische Ansatz in dieser Arbeit richtet das Augenmerk auf den kulturellen Synkretismus, den Nitsch und Schlingensief in ihren jeweiligen Theateraktionen über den ästhetischen Funktionsmodus des kulturellen Zelebrierens zum Vorschein bringen. An diesem Punkt geht die Arbeit über das postdramatische Theater hinaus und schlägt die Brücke zu antiken griechischen, mittelalterlichen und außereuropäischen bzw. afrikanischen Theaterformen. Konkret geht diese Arbeit von der Annahme aus, dass Nitschs Orgien-Mysterien-Theater und Schlingensiefs Aktion 18, „tötet Politik!“ als Inbegriff einer Radikalisierung gegenkultureller sowie institutionskritischer Erscheinungsformen von Kunst – wie z.B. Fluxus, Happening, Installations-, Interventions- sowie Aktionskunst – fungieren.
Das Orgien-Mysterien-Theater wird vor allem unter dem Gesichtspunkt der Institutions-, Religions- und Zivilisationskritik im Verhältnis zu gegenwärtigen soziokulturellen Begebenheiten untersucht. Dabei wird Nitschs synästhetische Dramaturgie als Kritik- und Transgressionsmittel dargestellt, um dadurch Menschen in synästhetische Wirklichkeitsbereiche seines Orgien-Mysterien-Theaters einzuführen. Es handelt sich dabei vor allem um solche synästhetische Wirklichkeitsbereiche, die in Form einer ästhetischen Ritualisierung bzw. einer selbstreferenziellen Zeremonie aus postdramatischer Sicht auf ein performatives Reflektieren über den menschlichen Körper im Theater, auf eine funktionelle ästhetisch-transformative Erfahrung, auf die Wiederherstellung fremd gewordener Erfahrungen und somit auf eine eigenartige kulturelle Praktik abzielen – in Verknüpfung mit der Opferbehandlung voraristotelischer Theaterpraxis. Nitschs theatrale Wiederherstellung voraristotelischer Theaterpraxen in den gegenwärtigen Lebensverhältnissen wird unter dem Begriff Urtheatralisierung subsumiert. Auch die Parallelen des Orgien-Mysterien-Theaters zu spätmittelalterlichen Oster- und Passionsspielen, die bis jetzt in der Nitschs Forschung unterbelichtet sind, werden in dieser Arbeit behandelt.
Die Auseinandersetzung mit Schlingensiefs Aktion 18, „tötet Politik!“ ist in der vorliegenden Arbeit eine erste umfangreiche Untersuchung dieser Aktion: sie wird zunächst in Relation zur postdramatischen Theaterästhetik und Urtheatralisierung als rituelles und politisches Ereignis gebracht, wobei der Akzent auf die sozialkritische und politische Dimension sowie auf die Einordnung in die gesellschaftskritische Theatertradition von der Aufklärung bis in die 1960er-Jahre gelegt wird. Die Produktions- und die Wirkungsästhetik der Aktion 18, „tötet Politik!“ wird auch hinsichtlich ihrer Kontextualisierung von Aktion, Raum und Zeit sowie der politischen Akteure_innen jenseits der Freizeitgattungen veranschaulicht. Schlingensiefs Fragmentierung und Entgrenzung des theatralen Schauplatzes, sein künstlerisches Schaffen von Ausnahmesituationen sowie -orten und seine störorientierten Strategien als Inszenierungsstil werden analysiert und am Beispiel seines Aufrufs „tötet Möllemann“ diskutiert. Ausgehend vom rituellen Vorgang in Aktion 18, „tötet Politik!“ wird zudem auf die postdramatische Theaterkomposition (vorkolonialer Zeit) in Afrika analytisch eingegangen und in Bezug auf sein Operndorf sowie auf die bereits erwähnten afrikanischen Theaterformen in kulturspezifischer und transkultureller Lesart behandelt.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird anschließend im dritten Kapitel Theater als Kunst bzw. Ästhetik kultureller Selbstreflexion und Selbstveränderung behandelt. In diesem Zusammenhang werden die postdramatische Ästhetik bis hin zum postdramatischen Theatersynkretismus sowie die Neuperspektivierung der Werkkategorie postdramatischer Ausprägung beleuchtet.
Die zentrale These der vorliegenden Arbeit lautet: Theater ist eine kulturelle Erscheinungsform des kompromissbereiten Praxis- und Erkenntnisschauplatzes. Es ist demnach als künstlerisches und ästhetisches Medium kultureller Kompromisssuche, Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung sowie Selbstveränderung aufzufassen.
1.4. Theater: ein Medium des kompromissbereiten Praxis- und Erkenntnisschauplatzes
Aufgrund der in dieser Analyse zu behandelnden Theaterformen bzw. -entwürfe, die sich sowohl auf entfernte als auch aktuelle zeiträumliche Kulturen beziehen, lässt sich Theater als Kunst und Ästhetik kultureller Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung und Selbstveränderung auffassen. Wie im zweiten Kapitel gezeigt wird, entspringen alle Theaterformen ihren jeweiligen zeiträumlichen, kulturspezifischen, sozialen und politischen Kontexten.1 Aus der Perspektive von cultural performance und kulturellem Zelebrieren ist Theater im Allgemeinen ein szenisch-dynamischer Schauplatz sowie ein ästhetisches und künstlerisches Medium kompromissbereiter, performativer Aushandelns- und Erkenntnispraxis. In einer Theatersituation geht es auch darum, die herrschenden Gesellschaftsordnungen auf die Probe zu stellen, um dadurch neue Keime individueller, kollektiver sowie soziokultureller Transformationen treiben zu lassen. Viele postdramatische Theaterformen – z.B. Nitschs Orgien-Mysterien-Theater und Schlingensiefs Aktion 18, „tötet Politik!“ – machen aber auf eine übertriebene Art und Weise Gebrauch von der Wirkungsästhetik der Theatersituation. Derartige postdramatische Verfahren lassen sich anhand des Begriffs Anagnorisis im Verhältnis zur Tragödie besser beschreiben:
Читать дальше