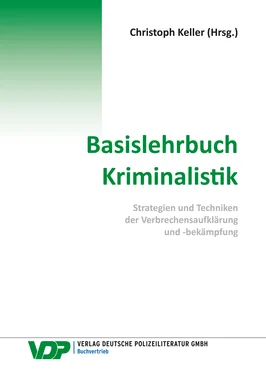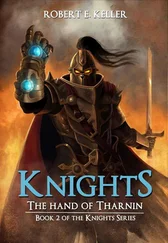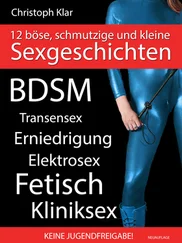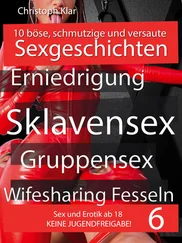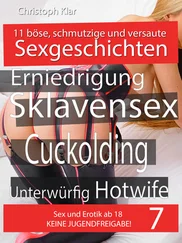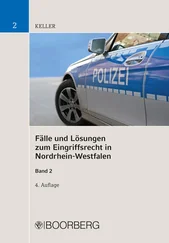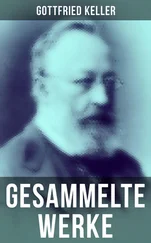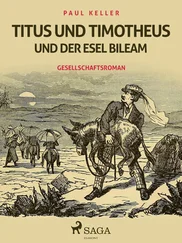1.2.Verpflichtung zur Aufnahme der Anzeige
Es ist allgemein anerkannt, dass die Zuständigkeit zur Entgegennahme einer Strafanzeige auch die Verpflichtung begründet, die Strafanzeige aufzunehmen. 34Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn es sich um eine offensichtlich unbegründete Strafanzeige handelt. Auch derjenige, der eine offensichtlich unbegründete Strafanzeige erstattet, hat einen Anspruch auf einen Bescheid nach§ 171 StPO und kann unter den Voraussetzungen des § 172 StPO das Klageerzwingungsverfahren betreiben. Diese Rechte würden dem Anzeigenden abgeschnitten, wenn seine Anzeige gar nicht erst aufgenommen würde. Es ist aber folgendes zu berücksichtigen: Es ist zulässig und kann in Einzelfällen zweckmäßig sein, auf den Anzeigenden mit dem Ziel einzuwirken, ihn von der Erstattung einer offensichtlich unbegründeten Strafanzeige abzubringen. Dem Anzeigenden kann auch die Erstattung einer schriftlichen Strafanzeige empfohlen werden. Besteht der Anzeigende gleichwohl auf einer mündlichen Anzeigeerstattung, so muss die Anzeige jedenfalls dann nicht sofort aufgenommen werden, wenn andere vordringlichere Dienstgeschäfte zu erledigen sind. Dem Anzeigenden kann dann ein späterer Termin für die Aufnahme der Anzeige gegeben werden.
Die in § 158 Abs. 1 Satz 2 StPO vorgeschriebene Beurkundung, die keiner bestimmten Form bedarf, muss erkennen lassen, wer welchen Sachverhalt angezeigt hat. Bei offensichtlich unbegründeten Strafanzeigen wird in der Regel eine sehr kurze Darstellung des angezeigten Sachverhalts ausreichen. Der aufnehmende Beamte ist nichtverpflichtet, alle Einzelheiten und weitschweifigen Ausführungen aufzunehmen, auf deren Aufnahme der Anzeigende besteht. Er hat nur das aufzunehmen, was ihm für die Darstellung des Sachverhalts wesentlich erscheint.
1.3.Verpflichtung zur Durchführung von Ermittlungen
Es sind die erforderlichen Ermittlungen zu führen, wenn der Verdacht einer Straftat besteht. Aus § 152 Abs. 2 StPO ergibt sich, dass dies dann der Fall ist, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Ist eine Strafanzeige von vornherein als unbegründet zu erkennen, so sind keine Ermittlungen zu führen. Die Verpflichtung, eine Strafanzeigeaufzunehmen, begründet also noch nicht die Pflicht, Ermittlungen zu führen. Die von A erstattete Strafanzeige ist nicht begründet. Ermittlungen sind deshalb nicht zu führen. Die Polizeibehörde wird den Vorgang der Staatsanwaltschaft übersenden, welche ein Ermittlungsverfahren gegen N einleiten und sofort einstellen wird.
1Zur Rolle der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren Artkämper, PSP 2/2013, 11 ff.; zum Verhältnis der StAzur Polizei Schaefer, Kriminalistik 2004, 753 ff.; Schünemann, Kriminalistik 1999, 74 ff. und 146 ff. Allgemein zur Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft Weidmann, Kriminalistik 2001, 378 ff.; Artkämper, Kriminalistik 2002, 146 ff.
2Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 170, Rn. 1.
3Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 152, Rn. 4.
4Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 152, Rn. 4b.
5BGHSt 38, 388 ff.
6Nimtz, 2016, S. 109.
7Fischer, 2017, § 258, Rn. 12.
8BGHSt 38, 388 (392).
9Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 158, Rn. 1.
10Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 158, Rn. 4.
11Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 158, Rn. 4, 11.
12Pientka/Wolf, 2017, Rn. 401.
13Feldmann/Hennings, 2010, S. 7; Dercks, NJW 1999, 1365 (1367).
14Grundlegend zur Aufnahme von Strafanzeigen Frings, PSP 4/2014, 14 ff.; Feldmann/Hennings, 2010, S. 93.
15BVerfG, StV 2017, 361.
16Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 158, Rn. 17.
17Mohr, Kriminalistik 2014, 554 (558).
18Instruktiv Loose/Henseler, JUS 2018, 346 ff.
19Brenneisen/Staack/Martins, Kriminalistik 2005, 436 (438).
20BGH, Beschl. v. 20.4.2017 – 2 StR 79/17, HRRS 2017, Nr. 698.
21Brenneisen/Staack/Martins, Kriminalistik 2005, 436 (438).
22Ausführlich zum Privatklageverfahren Bartsch, ZJS 2017, 40 ff.
23Brenneisen/Staack/Martins, Kriminalistik 2005, 436 (437).
24Zum Ablauf des Privatklageverfahrens Schroth/Schroth, 2018, Rn. 448 ff.
25Brenneisen/Staack/Martins, Kriminalistik 2005, 436 (437).
26Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 161, Rn. 18d.
27Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 147, Rn. 34.
28Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 147, Rn. 14.
29Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 147, Rn. 14.
30Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 147, Rn. 14a.
31Nowrousian, NStZ 2018, 254 (260).
32Kaefer, Kriminalistik 1999, 559.
33Kaefer, Kriminalistik 1999, 559 (560).
34Meyer-Goßner/Schmitt, 2018, § 158, Rn. 8.
Teil IV. Beweis und Verdacht
A.Verdacht
Verdachtsschöpfung und Verdachtsgewinnung sind Grundlagen und Ausgangspunkt der Beweiserhebung und der Beweisführung im Ermittlungsverfahren. Verdacht und Beweis stehen insoweit in einem engen Kontext. Der Verdacht begründet sich auf Anzeichen, das heißt Indizien, gegenständlicher oder nichtgegenständlicher Art, die einen Schluss auf einen noch ungeklärten Sachverhalt zulassen.
I.Strafprozessualer Verdacht
„Verdacht“ ist der zentrale Terminus des Ermittlungsverfahrens. Ohne Verdacht können keine Ermittlungsverfahren eingeleitet und keine grundrechtsverkürzenden Ermittlungsmaßnahmen getroffen werden. 1Das Vorliegen eines Anfangsverdachts ist also der „Zauberschlüssel“ für strafprozessuale Eingriffe in Bürgerrechte. Er markiert die gesetzliche Grenze, ab welcher der Staat mit dem Ziel der Strafverfolgung weit reichende und teils stark belastende Eingriffe in Grundrechte des Bürgers vornehmen kann 2(man denke etwa an Wohnungsdurchsuchungen oder eine Telefonüberwachung). Damit kommt dem Begriff des Tatverdachts auch eine Schutzfunktion zu: Solange ein Lebenssachverhalt die Voraussetzungen eines Anfangsverdachts nicht erfüllt, hat ein Bürger keine seine Grundrechte beschränkenden Strafverfolgungsmaßnahmen zu befürchten 3und insoweit ein Recht in Ruhe gelassen zu werden.
Nach § 152 Abs. 2 StPO sind die Ermittlungsbehörden verpflichtet, „wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“. Die Anforderungen an das Vorliegen eines solchen Anfangsverdachts sind eher geringer Natur. Allgemein anerkannt ist, dass ein durch konkrete Tatsachen belegter, in kriminalistischer Hinsicht begründeter Anhalt dafür gegeben sein muss, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt. 4Der Begriff „tatsächliche Anhaltspunkte“ gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist eindeutig. Tatsachen sind z.B. Aussagen von Opfern und Zeugen, eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen der Polizei, Gegenstände mit Aussagekraft und Beweiswert, Film- und Tonaufnahmen, Erkenntnisse aus den Kriminalakten z.B. zu bestimmten Tatbegehungsweisen (Modus Operandi). Zur Tatsachenbasis kommt noch eine Bewertungsphase. Sofern der Prozess der Beurteilung der Tatsachen zu dem Ergebnis führt, dass eine strafbare Handlung gegeben sein könnte, also eine höhere Wahrscheinlichkeit für als gegen das Vorliegen einer solchen Tat spricht, liegt ein Anfangsverdacht gemäß § 152 Abs. 2 StPO vor. 5
Der Anfangsverdacht muss sich jedenfalls auf mehr als bloße Hypothesen, vage Anhaltspunkte oder Vermutungen stützen lassen. 6Die Richtigkeit der verdachtsbegründenden Umstände muss nicht feststehen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist ausreichend. 7Der Tatverdacht muss sich nicht gegen eine bestimmte Person richten oder bereits auf eine einzelne Strafnorm beziehen. Es reicht aus, dass zumindest eine Strafnorm durch das unterstellte Geschehen verwirklicht worden sein kann. 8Diese „unterste Verdachtsstufe“ 9besteht gleichwohl nur bei „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten“; wenn also nach kriminalistischer Erfahrungdie Verwirklichung einer Straftat möglich erscheint. Eine solche geringe Wahrscheinlichkeit genügt gemäß § 152 Abs. 2 StPO für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens; sie muss aber trotzdem auf Tatsachen, nicht bloß auf Vermutungen beruhen. 10Das Erfahrungswissenist in der täglichen Arbeit sicherlich nicht zu unterschätzen. Informationen und Daten werden mit persönlich gemachten Erfahrungen verknüpft, sodass eine zielgerichtete Analyse und Bewertung der Informationslage beim Kriminalisten entsteht, die für den Gang des Ermittlungsverfahrens von entscheidender Bedeutung sein kann. 11Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht immer offen; es erkennt sie nur, wer auch zu verdächtigen weiß beziehungsweise wer den „richtigen Riecher“ hat. Schon früh hat Walder darauf hingewiesen, „dass die Fähigkeit, leicht Verdacht zu fassen, nicht nur die Grundlage der erfolgreichen kriminalistischen Arbeit, sondern auch der paranoiden Schizophrenie ist“. Von Edgar Allen Poe wird behauptet, er habe die Detektivgeschichten erfunden, damit er nicht verrückt werde. Seine Erfindungen haben ihn leider nicht zu schützen vermocht. Neuere Erkenntnisse der Forschung zeigten, was den besonders Kreativen auszeichnet: Er verfolgt auch diejenigen Ideen weiter, die bei weniger Kreativen vom Hirn als unerwünscht ausgefiltert werden; das Fehlen des Filters kann aber eben auch zu Geisteskrankheit führen“ 12.
Читать дальше