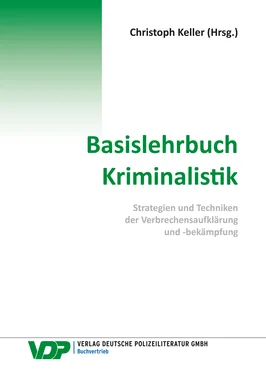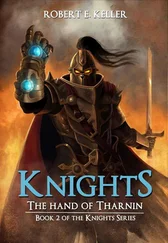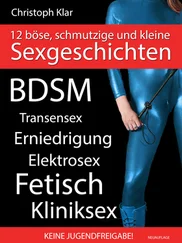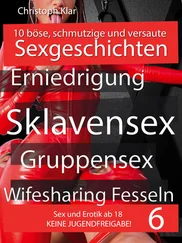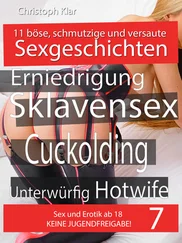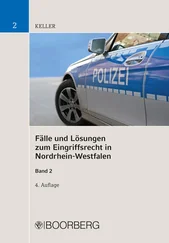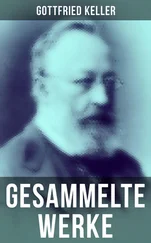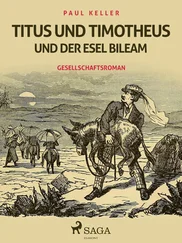Rein praktisch stellt sich namentlich in Umfangsverfahren , also Verfahren mit vielen Beschuldigten und beziehungsweise oder Tatvorwürfen, die Frage, wie die Akten eigentlich aufgebaut werden sollen, damit sie auch bei hohen, teils viele Tausende Seiten umfassenden Blattzahlen noch handhabbar und lesbar bleiben. Die bei kleineren Verfahren geübte Praxis , einfach sämtliche für das Verfahren geschaffene Schriftstücke beziehungsweise für die Straf- und Schuldfrage Relevantes nach Eingang chronologisch in einen Band zu heften, kommt hier nicht in Betracht. Ein Hauptband mit Tausenden vonseiten wäre unlesbar. Üblich und empfehlenswert ist hier, dass man in einem Hauptband lediglich dasjenige sammelt, woraus sich der chronologische Verfahrens gang ergibt, und die Ermittlungs ergebnisse fallbezogen in sogenannten Fallakten zusammenfasst. Gesonderte Akten werden daneben im Regelfall noch für Durchsuchungen geführt, wobei diese dann nur den Antrag, den Beschluss sowie die Protokolle zur Durchführung und zu den sichergestellten Beweismitteln enthalten, sowie eigene Zeugen- und Beschuldigtenbände für die Sammlung der dortigen Aussagen. Die Variationsbreite ist hier allerdings groß. Bei Umfangsverfahren hat die Polizei die Aktenführung daher von Beginn an mit der Staatsanwaltschaft zu besprechen .
V.Besonderheiten bei verdeckten technischen Überwachungsmaßnahmen
Im Gesetz geregelt ist schließlich eine weitere Besonderheit: Nach § 101 Abs. 2 StPO sind bei den dort aufgeführten Maßnahmen der verdeckten technischen Überwachung, alle deren Anordnung und Ergebnisse betreffenden Umstände bis zum Abschluss der Ermittlungen in Sonderbänden zu führen. Weder die Beantragung der Maßnahme und deren richterliche Anordnung noch deren Durchführung und deren Ergebnisse darf sich mithin aus den übrigen Aktenbänden ergeben. All dies muss separat in Sonderbänden (z.B. „SB TKÜ“) geführt werden. Erst wenn die Maßnahme offengelegt werden kann, was meist erst mit Abschluss der Ermittlungen möglich ist, werden diese Sonderbände dann zu den übrigen Verfahrensakten genommen.
VI.Aktenordnungen, Aktenregister, Aktendoppel
Jenseits dieser Grundsätze ergibt sich das Weitere zur Aktenführung und zur administrativen Erfassung von Ermittlungsakten aus den jeweiligen Aktenordnungen der Bundesländer beziehungsweise bei Bundesbehörden des Bundes. Bekannt sein sollte jedem Polizeibeamten dabei das Folgende:
•Wird Anzeige erstattet (und zwar unabhängig davon, ob diese einen Anfangsverdacht begründet oder nicht) oder von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet, weil ein Anfangsverdacht bei Kenntniserlangung von Amts wegen bejaht wurde, erhalten die Akten bei der Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Js-Aktenzeichen . Ein solches Aktenzeichen lautet dann z.B.: 570 Js 123/18. Die Zahl „570“ bezeichnet lediglich die Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft, die die Akten verwaltet. Je nach Bezeichnung variiert diese Zahl also von Behörde zu Behörde. Immer gleich verwendet werden aber die Zahlen nach den Buchstaben „Js“. „18“, also die Zahl nach dem Querstrich, bezeichnet das Jahr der Erfassung. „123“, also die Zahl vor dem Querstrich, gibt an, das wievielte erfasste Verfahren dies bei dieser Staatsanwaltschaft im Jahr der Erfassung war. Jeder, der diese Systematik kennt, kann also bei jedem Strafverfahrensaktenzeichen in Deutschland die genannten Informationen erkennen!
•Verfahren, in denen lediglich Vorermittlungen geführt werden, sowie „Hinweise“, falls diese keinen Anfangsverdacht begründen, erhalten bei der Staatsanwaltschaft kein Js-, sondern ein AR-Aktenzeichen . Der Aufbau ist sonst gleich, also etwa „570 AR 123/18“. Ebenfalls bloß ein AR-Aktenzeichen erhalten Anzeigen gegen Personen, bei denen ein Verfolgungshindernis besteht.
•Bei Haftsachen, also immer, wenn ein Haftbefehl beantragt wird, muss ein vollständiges Aktendoppel geführt werden.
Nach wie vor nur in Probeläufen ist bei den Strafverfolgungsbehörden die elektronische Aktenführung. Zwar werden in Haftsachen wie auch in Umfangsverfahren die dort üblichen Aktendoppel mittlerweile meist elektronisch geführt. Für die Masse der Ermittlungsverfahren gibt es aber nach wie vor nur Papierakten . Wann die schon lange geplante obligatorische elektronische Aktenführung tatsächlich kommt, bleibt abzuwarten.
L.Fallbeispiel: Aufnahme von Strafanzeigen und Strafanträgen
1.Sachverhalt 32
Der 30jährige A ruft bei der für seinen Wohnsitz zuständigen Polizeibehörde an und teilt Kriminaloberkommissar K seine Personalien mit. Er erklärt, er erstatte gegen seinen Nachbarn N Strafanzeige wegen Beleidigung und stelle gleichzeitig Strafantrag. A führt aus, N sei in den vergangenen Wochen mehrmals – zuletzt am Abend des vergangenen Tags – in die Tagesschau der ARD eingeblendet worden und habe ihn, A, in den Sendungen beschimpft sowie als „verrückt“ und „asozial“ bezeichnet. K versucht erfolglos, A von einer Strafanzeige abzubringen. Dieser wiederholt, dass er auf einer Bestrafung des N bestehe. Aufgrund eines in einem anderen Verfahren erstellten ärztlichen Gutachtens ist bekannt, dass A nicht an einer die freie Willensbestimmung ausschließenden Geisteskrankheit leidet.
•Hat A wirksam Strafanzeige erstattet?
•Ist K verpflichtet, die Strafanzeige des A aufzunehmen?
•Sind aufgrund der Strafanzeige des A Ermittlungen zuführen?
3.Lösungshinweise 33
1.1.Wirksame Erstattung einer Strafanzeige
In § 158 Abs. 1 Satz 1 StPO ist geregelt, bei welcher Stelle und in welcher Form die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag angebracht werden können. Unter der in dieser Bestimmung bezeichneten Anzeige einer Straftat ist die Mitteilung eines Sachverhalts zu verstehen, der nach der Ansicht der mitteilenden Person den Verdacht einer Straftat begründet. Der in § 158 Abs. 1 Satz 1 StPO verwendete Begriff des Strafantrags ist missverständlich. Damit ist nicht der Antrag gemeint, der eine Prozessvoraussetzung für die Verfolgung der sogenannten Antragsdelikte – beispielsweise des Hausfriedensbruchs nach § 123 StGB – ist und der nach § 77 Abs. 1 StGB grundsätzlich nur vom Verletzten gestellt werden kann. Bei welcher Stelle und in welcher Form dieser für die Verfolgung eines Antragsdelikts erforderliche Antrag zu stellen ist, ist in § 158 Abs. 2 StPO geregelt. Demgegenüber ist der in § 158 Abs. 1 StPO verwendete Begriff des Strafantrages im weiteren Sinne zu verstehen. Die in § 158 Abs. 1 Satz 1 StPO bezeichneten Begriffe der Anzeige einer Straftat und des Strafantrags werden in der Regel unter dem Begriff der Strafanzeige zusammengefasst. Unter Strafanzeige ist daher die Mitteilung von dem Verdacht einer Straftat zu verstehen, die nach dem Willen des Anzeigenden strafrechtlich verfolgt werden soll. Eine Strafanzeige kann von jedermann erstattet werden.
Der Anzeigende braucht weder durch die zur Anzeige gebrachte Tat verletzt noch unmittelbar oder mittelbar berührt zu sein. Es ist nicht erforderlich, dass der Anzeigende geschäfts- oder prozessfähig ist. A will in Bezug auf den von ihm mitgeteilten Sachverhalt eine strafrechtliche Verfolgung des N erreichen. Deshalb ist davon auszugehen, dass er eine Strafanzeige erstattet hat. Dem steht nicht entgegen, dass die Strafanzeige offensichtlich unbegründet und nicht realitätsbezogen ist. Für die Strafanzeige ist eine bestimmte Form nicht vorgeschrieben. Sie kann nach § 158 Abs. 1 Satz 1 StPO mündlich oder schriftlich erstattet werden. Eine telefonische Strafanzeige ist in mündlicher Form angebracht. Nach§ 158 Abs. 1 Satz 1 StPO gehören die Polizeibehörden zu den Stellen, bei denen die Strafanzeige erstattet werden kann. A hat demnach eine Strafanzeige mündlich bei einer zuständigen Stelle angebracht, also wirksam Strafanzeige erstattet.
Читать дальше