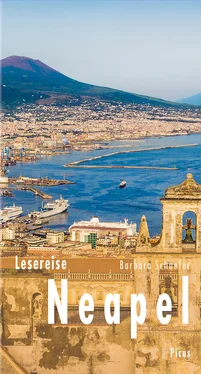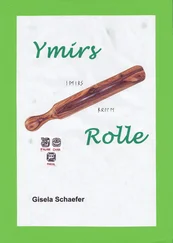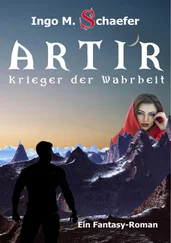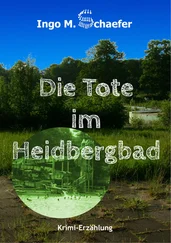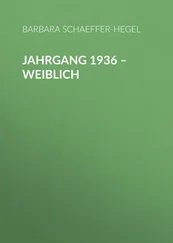Unter der Pestsäule am Largo San Domenico hocken Studierende, und an den Straßenständen staubt ein fliegender Händler die grün verspiegelten Sonnenbrillen mit einem Federbusch ab. Wie viel Staub und Dreck in der Luft Neapels hängt, merkt man abends im Hotel, wenn man sich das Gesicht wäscht und eine schwarze Brühe ins Waschbecken gluckert.
Eine Ecke weiter breiten Straßenhändler, meist Schwarzafrikaner, auf Kartons oder Laken ihre Ware aus. Bis die carabinieri sie verjagen. Zwei Zivilpolizisten kommen: »Hopp, zusammenpacken!« Die Afrikaner schnappen sich die vier Zipfel ihrer Betttücher, auf denen sie ihre Fake-Handtaschen ausbreiten, und sind weg. Scusi , entschuldigen sie sich noch bei der Polizei. Für den Fehler, nicht gemerkt zu haben, dass Polizei kommt. Und gehen eine Ecke weiter und packen wieder aus. Natürlich sind gefälschte Waren auch in Italien verboten. Die Straßenhändler sind nur die sichtbaren, kleinen Leute, das Geschäft dahinter macht die Camorra. In einem Bild zusammengefasst hat das Banksy. Auf der kleinen Piazza Gerolomini prangt ein kleines Bild des britischen Streetart-Künstlers. Es zeigt eine Madonna, in deren Heiligenschein eine Pistole steckt; Katholizismus und Camorra in einem Bild vereint.
Noch einmal Kunst, aber diesmal hauswandgroß, taucht bald auf. Sie leitet den Übergang zum Stadtviertel Forcella ein, ein harter Kiez, auf einmal sind kaum noch Touristen zu sehen. Um das zu ändern, schuf der Straßenkünstler Jorit Agoch das riesige Mural. Es zeigt San Gennaro, den echten Stadtheiligen Neapels.
Wer weitergeht, lernt mehr über die Stadt als beim Spaziergang im oberen Teil von Spaccanapoli. Denn was Neapel tatsächlich spaltet, und eben vieles zerstört, sind die brutalen kriminellen Hintergründe. In der Via Vicaria Vecchia listet ein Schriftband mit dem Titel #noninvano endlos viele Namen auf, »le vittime innocenti della criminalità in Campania« , die unschuldigen Opfer der Kriminalität in Kampanien, die eben nicht umsonst – invano – gestorben sein sollen. Bald folgt die Associazione Annalisa Durante, eine Art Stadtbibliothek und Sozialzentrum, gewidmet der Vierzehnjährigen, die bei einer Schießerei ums Leben kam. An der Wand hängt ein Zeitungsartikel, in dem der Vater des Mädchens bewegend erzählt.
Hier, wo im Erdgeschoss nicht die Souvenir- Curnicielli verkauft werden, wirkt Spaccanapoli noch wie vor dem Tourismusboom. Hier wohnen in den ebenerdigen Wohnungen, den bassi , noch die einfachen und oft armen Leute. Jene bassi , auch bekannt unter der neapolitanischen Bezeichnung o Vascio , sind kleine Häuser mit ein oder zwei Räumen im Erdgeschoss und direktem Zugang zur Straße. Durchs Fenster sieht man direkt ins Wohnzimmer, da steht oft das motorino , der Motorroller, zwischen Fernseher und Schlafcouch.
Die neapolitanische Schriftstellerin Matilde Serao, die einige Jahre in einem basso lebte, beschreibt diese so: »Häuser, in denen man im Kabuff kocht, im Schlafzimmer isst und im selben Raum stirbt, in dem andere schlafen und essen; Häuser, deren Keller, die ebenfalls von Menschen bewohnt sind, den alten Strafgefängnissen ähneln.« Die bassi galten als Synonym für Wohnungen armer Leute, aus ihnen heraus gab es wegen der schlechten hygienischen Bedingungen Pestepidemien und Cholera-Ausbrüche. 1881 existierten nach einer Volkszählung rund dreiundzwanzigtausend bassi , in denen hundertfünftausend Neapolitaner lebten, das war aber noch nicht der Höchststand. 1931 waren es über dreiundvierzigtausend mit fast zweihundertzwanzigtausend Bewohnern. Das war ein Viertel der Einwohner Neapels.
Manche bassi sind heute umgemodelt zu Ferienwohnungen, B & B, wie das auch in Italien heißt. Wobei das zweite »B«, das Breakfast, auch gerne mal aus einer Schublade mit Zwieback, Keksen und Kaffeepulver besteht. Sucht man auf den einschlägigen Plattformen nach einer zentralen Unterkunft, muss man sich die Fotos schon genau ansehen. Manchmal sehen die Apartments toll aus, sind schön möbliert, aber alles wirkt lichtlos. Moment, wo ist denn da das Fenster? Es gibt keines. Wenn man eintritt, steht man bereits zwischen Bett und Tisch.
Am Ende des Spaziergangs durch den Bauch von Neapel (so heißt ein berühmtes Buch der schon zitierten Matilde Serao) erkennt man: Spaccanapoli ist gar nicht so sehr eine Zerteilerin, sondern hat etwas Verbindendes. Vom edlen Wohnviertel Vomero über eine gewöhnliche Nachbarschaftsgegend, durch die touristische Zone, weiter in ein schwieriges Viertel, gezeichnet von den Narben der Kriminalität.
Aber auch ganz normaler Alltag, wie am Anfang der Straße, wo wie hier auch wieder die Wäsche zum Trocknen von Haus zu Haus aufgespannt hängt. Statt Souvenirläden bieten hier die lokalen Minisupermärkte alles, was man so braucht. Jetzt etwa dringend Papiertaschentücher, um die vom Staub verklebte Nase zu reinigen. In der Auslage, zwischen Obststeigen und billigen Keksen, sind keine zu sehen, also drinnen nachgefragt. Die Verkäuferin zieht eine Packung hervor, also einen Zehnerpack. So viel wollte man nun eigentlich nicht. »Drei Euro«, sagt sie. »Woanders verkauft man Ihnen ein einzelnes Päckchen für einen Euro, jetzt nehmen Sie schon!« Wer wollte da widersprechen.
Das Ende von Spaccanapoli führt auf den Hauptbahnhof zu. Der ist, wie in vielen anderen Städten auch, das Viertel mit der am stärksten internationalen und multikulturellen Bevölkerung. Dazu später mehr.
Neapel sehen
– und Schokolade essen
Tritt man aus der Hitze der Stadt in die Verkaufsräume von Gay-Odin, empfängt einen angenehme Kühle. Die Temperatur gilt allerdings nicht den Kunden, sondern den sensiblen Produkten: Gay-Odin ist Neapels bekanntester Schokoladenhersteller, eine erstaunliche Tradition in einer so heißen Stadt. Auf dem Tresen versammeln sich zauberhaft verpackte Schokoladen, in Spanschachteln, die der Vesuv ziert, in Bonbonnieren, in Cellophan. Viele versehen mit dem jugendstilig verschnörkelten Firmennamen.
»Essen Sie eigentlich noch Süßes, Massimo Schisa?« Der Geschäftsführer von Gay-Odin verdreht die Augen: »Und ob!« Gestern habe er jedoch mit einer Diät angefangen. Das brauche er jährlich.
Gay-Odin, welch seltsamer Name. Er hat nichts mit dem Göttervater Odin/Wotan zu tun, sondern setzt sich aus zwei Familiennamen zusammen. Alles begann mit Isidoro Odin, einem jungen Mann aus dem Piemont. Der wanderte 1888 in den Süden Italiens aus, das war damals nicht so ungewöhnlich. Isidoro war ein aufstrebender junger Mann, er wollte in seinem Leben etwas erreichen. Da war das moderne Neapel die Stadt der Wahl.
Aber erst seit Kurzem. Noch in den Jahrzehnten davor hatten Seuchenausbrüche die dicht bevölkerte Stadt verwüstet. 1884 tötete eine weitere Cholera-Epidemie achttausend Einwohner. Neapel verzeichnete die höchste Sterberate europäischer Großstädte. Die knapp eine halbe Million zählende Einwohnerschaft der süditalienischen Metropole lebte auf engstem Raum. Nach der Katastrophe begann Neapel 1888 mit dem risanamento – gigantischen städtebaulichen Sanierungen, die die hygienischen Zustände verbessern sollten. Ganze Viertel wurden abgerissen, Schneisen in die enge Altstadt geschlagen, neue Stadtviertel entstanden.
Man sprach davon, die Stadt auszunehmen, ihr den Bauch aufzuschlitzen – sventrare – ein Wortspiel, das Bezug nahm auf den bald schon berühmten Roman »Il ventre di Napoli« (1884), »Der Bauch Neapels«, in dem Matilde Serao das Leben in der Altstadt geschildert hatte. Auch die mit einer großen Glaskuppel überdachte Einkaufspassage Galleria Umberto I wurde ab 1887 erbaut und war Teil dieser Stadterneuerung. Der gesamte Umbau brachte Luft in die Altstadt, hatte aber auch eine erste Welle der Gentrifizierung zur Folge. Denn in den schicken Palais zu wohnen, konnte sich nur das Bürgertum leisten. Hinter den potemkinschen Stadtpalästen entlang der neuen Straßen änderte sich in der Altstadt wenig.
Читать дальше