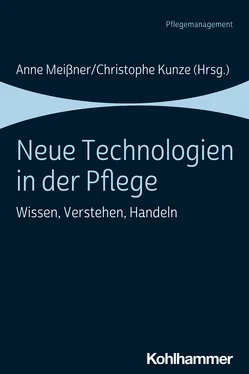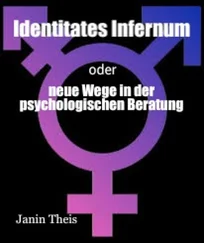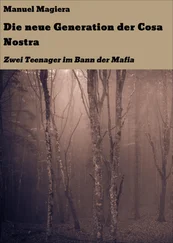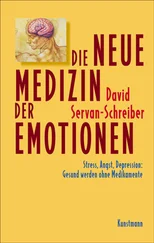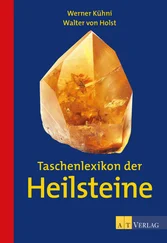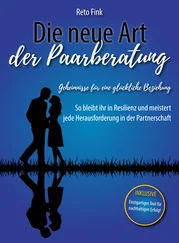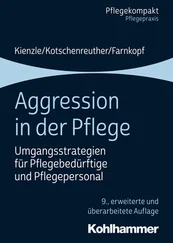1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Der Einsatz von Technik in Pflege und Versorgung ist nicht trivial. Passen sich die technischen Systeme in das Alltagsleben Betroffener ein, werden sie akzeptiert und genutzt, erreichen sie überhaupt das gesetzte Ziel, sind sie ethisch akzeptabel? Das sind nur einige Fragen, die es in diesem Diskurs zu stellen gilt. Sicher ist:
• Technik hat Potenzial
und
• Technik hat Grenzen.
Diese Grenzen lebensdienlich auszuloten ist unsere Aufgabe. Dabei bedarf es eines vorausschauenden Weitblicks einerseits und einer stabilen Bodenhaftung andererseits. Die folgenden Beiträge haben zum Ziel, Potenzial aufzuzeigen, Wissen zu ermitteln, um Verständnis zu ermöglichen, Grenzen auszuloten und so zum Diskurs anzuregen.
Böhle, F., Weihrich, M. & Stöger, U. (2015). Interaktionsarbeit gestalten. Vorschläge und Perspektiven für humane Dienstleistungsarbeit (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 168). Berlin: Edition Sigma. https://doi.org/10.5771/9783845268279
Deutscher Ethikrat. (2020). Robotik für gute Pflege. Stellungnahme (Deutscher Ethikrat, Hrsg.). Verfügbar unter https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-robotik-fuer-gute-pflege.pdf
Dunkel, W. & Weihrich, M. (2010). Kapitel II Arbeit als menschliche Tätigkeit: Arbeit als Interaktion. In G. G. Voß, G. Wachtler & F. Böhle (Hrsg.), Handbuch Arbeitssoziologie (S. 177–200). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92247-8_6
Hülsken-Giesler, M. & Daxberger, S. (2018). Robotik in der Pflege aus pflegewissenschaftlicher Perspektive. In O. Bendel (Hrsg.), Pflegeroboter (S. 125–140). Wiesbaden: Springer Gabler.
Hülsken-Giesler, M. (2015). Technik und Neue Technologien in der Pflege. In H. Brandenburg & S. Dorschner (Hrsg.), Pflegewissenschaft (3., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 262–279). Bern: Hogrefe Verlag.
Huter, K., Krick, T., Domhoff, D., Seibert, K., Wolf-Ostermann, K. & Rothgang, H. (2020). Effectiveness of digital technologies to support nursing care: results of a scoping review. https://doi.org/10.21203/rs.2.24344/v1
Kerres, M. (2020). Jahrbuch Medienpädagogik 17: Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt. MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 17(Jahrbuch Medienpädagogik), 1–32. https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.04.24.X
Kohnke, O. (2015). Anwenderakzeptanz unternehmensweiter Standardsoftware. Theorie, Einflussfaktoren und Handlungsempfehlungen (Research). Zugl.: Mannheim, Univ., Habil-Schr. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-08206-2
Kramer, U., Borges, U., Fischer, F., Hoffmann, W., Pobiruchin, M. & Vollmar, H. C. (2019). DNVF-Memorandum – Gesundheits- und Medizin-Apps (GuMAs). Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Offentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)) [DNVF-Memorandum – Health and Medical Apps], 81(10), e154-e170. https://doi.org/10.1055/s-0038-1667451
Krick, T., Huter, K., Domhoff, D., Schmidt, A., Rothgang, H. & Wolf-Ostermann, K. (2019). Digital technology and nursing care: a scoping review on acceptance, effectiveness and efficiency studies of informal and formal care technologies. BMC Health Services Research, 19(1), 400. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4238-3
Krick, T., Huter, K., Seibert, K., Domhoff, D. & Wolf-Ostermann, K. (2020). Measuring the effectiveness of digital nursing technologies: development of a comprehensive digital nursing technology outcome framework based on a scoping review. BMC Health Services Research, 20(1), 243. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05106-8
Kunze, C. (in press). Nutzerorientierte und partizipative Ansätze in Gestaltungs- und Aneignungsprozessen von teilhabefördernder Technik. In M. Schäfers & F. Welti (Hrsg.), Barrierefreiheit – Zugänglichkeit – Universelles Design. Bad Heilbrinn: Klinkhard.
Kunze, C. (2017). Technikgestaltung für die Pflegepraxis: Perspektiven und Herausforderungen. Pflege & Gesellschaft, (2), 130–145.
Meißner, A. (2018). How can new care technologies support equality & wellbeing of older people? unveröffentlichter Bericht zur Joint Programming Initiative »More years Better Lives – The Potenzial and Challenges of Demographic Change«.
Peek, S.T.M. (2017). Understanding technology acceptance by older adults who are aging in place: A dynamic perspective. PhD Thesis. Ipskamp.
Pols, J. (2017). Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care. Nursing Philosophy: an International Journal for Healthcare Professionals, 18(1). https://doi.org/10.1111/nup.12154
Rosa, H. (2005). Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Sandelowski, M. (2005). Devices & desires. Gender, technology, and American nursing (Studies in social medicine, Repr). Chapel Hill, SC: Univ. of North Carolina Press. Retrieved from http://www.loc.gov/catdir/description/unc041/00032588.html
Zöllick, J. C., Kuhlmey, A., Suhr, R., Eggert, S., Nordheim, J. & Blüher, S. (2019). Zwischenergebnisse einer Befragung unter professionell Pflegenden. In K. Jacobs, A. Kuhlmey & S. Greß (Hrsg.), Mehr Personal in der Langzeitpflege – aber woher? (Pflege-Report, S. 211–218).
Teil II Den Pflegealltag mit Technik gestalten: Einsatzfelder heute
1 Digitale Medien und soziale Betreuung von Menschen mit Demenz
Beate Radzey
1.1 Der Kontext: Technische Hilfen für Menschen mit Demenz
Demenzen sind eine der häufigsten Erkrankungsformen, die im höheren Lebensalter auftreten können. Daneben verändern Demenzen das bisherige Leben am einschneidensten von allen Erkrankungen. Aktuelle Zahlen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft gehen davon aus, dass derzeit ca. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland von einer demenziellen Erkrankung betroffen sind (Bickel 2018). Neben den primären kognitiven Symptomen treten im Krankheitsverlauf auch motorische und funktionale Einbußen auf. Diese haben großen Einfluss auf die Progredienz und damit auch auf die Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensführung der Betroffenen. Um so gut wie möglich im Alltag zurechtzukommen, brauchen Menschen bei kognitiven Einschränkungen Beistand in vielerlei Form.
Auch in der Betreuung und Pflege von demenziell erkrankten Menschen haben bedarfsgerechte technische Lösungen und technikgestützte Betreuungskonzepte das Potenzial einen wertvollen Beitrag zu leisten (Ienca et al. 2017). Die Entwicklung neuer Technologien schreitet aktuell rasch voran. Es ist sogar die Sprache von einer technischen Revolution im Feld von Demenz. So hat sich die Zahl der entwickelten Technologien innerhalb der letzten fünf Jahre verdoppelt mit weiter steigender Tendenz (Ienca et al. 2017). Allerdings steht diesem technischen Innovationsschub die Tatsache entgegen, dass die tatsächliche Verbreitung dieser Produkte in Pflege und Versorgung noch vergleichsweise gering ist. Dies wird in der Regel mit einem fehlenden Wissenstransfer sowie unzureichenden Strategien für die Verbreitung dieser Produkte begründet (ebd.).
Ebenso fehlt es an Studien, die zuverlässig die Wirksamkeit der entwickelten technischen Lösungsansätze untersuchen. Die wenigen vorhandenen Studien weisen oft erhebliche methodische Mängel, wie z. B. geringe Fallzahlen auf. Bisher zeigt sich, dass der Weg der neuen Technologien aus den Forschungs- und Entwicklungslaboren in die realen Lebenssituationen von Menschen mit Demenz mühsam ist (Fleming & Sum 2014).
Ein weiteres, aber nicht zu unterschätzendes Problem mag auch der bisher fehlende Fokus auf die eigentlichen Bedürfnisse der Betroffenen sein. In einer seit längerer Zeit vorliegenden Studie haben Sixsmith et al. (2007) auf der Basis von Interviews mit Menschen mit Demenz eine »Technik-Wunschliste« erarbeitet. Dabei stehen Unterstützungsbereiche wie die Förderung der Erinnerung und des Erhalts der eigenen Identität, die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen, die Unterstützung bei Konversationen oder auch die Förderung der Nutzung von Musik im Vordergrund. Diese Zielsetzungen fanden bisher bei den meisten technischen Entwicklungen für Menschen mit Demenz nur wenig Berücksichtigung.
Читать дальше