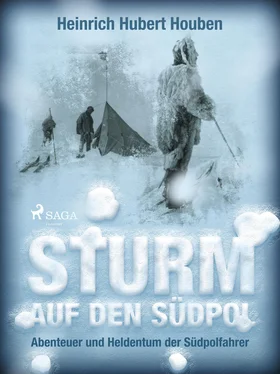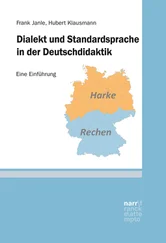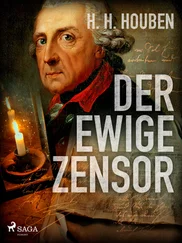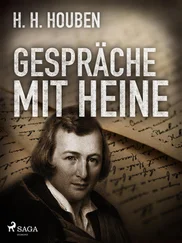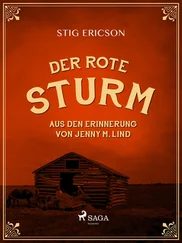Das erste Schiff, das sich um die Ankunft der Franzosen bekümmert, ist eine englische Fregatte. D’Urville kann sich dem Verkehr mit den englischen Kollegen nicht entziehen; sie überlassen ihm sogar mit grösster Hilfsbereitschaft 150 Kupferplatten, die er zur Instandsetzung seiner Schiffe braucht und sich nirgends anders beschaffen kann, und nehmen nach Valparaiso seine Post mit, seine ersten Berichte über die bisherigen Ergebnisse der Reise. Denn es dauert vier Wochen, bis seine Mannschaft sich wieder erholt hat und er ebenfalls dahin aufbrechen kann.
Die Nachricht von seiner Ankunft ist ihm vorausgeeilt und hat auf dort weilenden französischen Schiffen grosse Bestürzung verursacht. Die Offiziere empfinden das Unternehmen schon als eine Blamage Frankreichs, und ihr hitziger Patriotismus macht sie ungerecht gegen den eigenen Landsmann; einer von ihnen schreibt einem Freunde auf dem „Astrolabe“, dem Kommandanten der verunglückten Expedition bleibe nichts übrig, als sich eine Kugel vor den Kopf zu schiessen! Als d’Urville schliesslich selbst mit seiner wieder seetüchtigen Mannschaft und tadellosen Schiffen in Valparaiso erscheint, ist es seine peinlichste Aufgabe, die übertriebenen und erlogenen Gerüchte über den kläglichen Zusammenbruch der ganzen Expedition zu widerlegen und besonders die misstrauischen Landsleute eines Bessern zu belehren. — Sehr erpicht ist er darauf, zu erfahren, was unterdes aus der amerikanischen Expedition geworden ist; aber davon hat niemand etwas gehört; anscheinend ist sie noch gar nicht abgereist.
Entdeckung des Adélie-Landes
Als die französische Expedition nach einer sehr erfolgreichen Forschungsreise durch ganz Ozeanien am 12. Dezember 1839 in den Hafen von Hobart einläuft, ist sie weit schlimmer noch daran als vor anderthalb Jahren. An den sumpfigen Küsten Javas haben Ruhr und Fieber die beiden Schiffe derart verseucht, dass kaum noch ein völlig Gesunder an Bord ist; 16 Mann, darunter 3 Offiziere, sind auf der zwei Monate langen Fahrt nach Tasmania gestorben. Abermals wird in der Hafenstadt ein Hospital errichtet, und noch hier fordert die Krankheit neue Opfer. Kann die zweite Antarktisfahrt nicht am 1. Januar beginnen, dann wird es zu spät im Jahr, um Erfolge zu erzielen, die d’Urvilles eigenmächtigen Entschluss rechtfertigen können; Briefe aus der Heimat melden ihm, dass seine erste Fahrt keinen günstigen Eindruck dort gemacht hat. An Wiederherstellung aller Kranken in drei Wochen ist nicht zu denken; wer weiss, ob ihm noch genug Leute auch nur für ein Schiff übrigbleiben! Aber seiner Absicht, mit dem „Astrolabe“ allein den zweiten Vorstoss in die Antarktis zu machen, widersetzen sich Freund Jacquinot und seine Offiziere mit Leidenschaft: „Wir dürfen uns doch da nicht trennen, wo es am notwendigsten ist, beisammen zu sein!“ Dem muss der Kommandant beipflichten. Die Lücken in der Mannschaft werden also notdürftig durch Werbung Freiwilliger ausgefüllt; es sind meist Deserteure von Walfängern, Franzosen und sogar Engländer! Noch am Tage vor der Abfahrt stirbt der junge Künstler Goupil, der Zeichner der Expedition, und die vom Arzt gesundgeschriebenen Leute sehen keineswegs so aus, als ob sie den drohenden Strapazen gewachsen sind. Die Verantwortung des Kommandanten ist doppelt schwer.
Überall hat d’Urville herumgefragt: was aus der amerikanischen Expedition geworden sei? Niemand weiss etwas davon; der englische Gouverneur von Tasmanien, Sir John Franklin, der berühmte Polarfahrer, versichert ihm, nie auch nur davon sprechen gehört zu haben. Erst am 24. Dezember erfährt er, dass Wilkes mit seiner Flotte in Sydney ist, nur wenige Tagereisen von Hobart entfernt, und sich aus seine zweite Eisfahrt vorbereitet; niemand weiss etwas über seine bisherigen Entdeckungen; allen Mitgliedern der amerikanischen Expedition ist strengstes Stillschweigen auferlegt. Andern Tags besucht ihn überraschend genug der Entdecker von Graham- und Enderbyland, Kapitän Biscoe, selbst; er kommt auf seinem Enderby-Schiff soeben von Sydney, hat Wilkes gesprochen, aber auch nichts Näheres über seine Erlebnisse herausholen können. Biscoe hat kürzlich wieder einen Vorstoss nach Süden versucht, und zwar auf dem Meridian von Neuseeland, ist aber nur bis zum 63. Breitengrad gekommen; mehrere Kollegen haben ihm übrigens versichert, im Süden der Macquarie-Insel müsse Land sein, aber bisher sei noch keiner da hinuntergesegelt. Biscoe hat offenbar etwas läuten gehört, ohne noch zu wissen, wo die Glocken hängen, und d’Urville ahnt noch weniger, was sich neuerdings während seines Aufenthalts in Ozeanien, begeben hat: ein anderer Enderby-Schiffer, Kapitän John Balleny, ist, um Robben zu fangen, mit zwei kleinen Fahrzeugen, der „Eliza Scott“ (154 T.) und dem Kutter „Sabrina“ (54 T.), von den Campbell-Inseln aus, also auf dem Meridian von Neuseeland, südwärts gefahren, bis zum 69. Breitengrad gekommen und hat am 9. Februar 1839 tatsächlich südlich von der Macquarie-Insel jenseits des 66. Breitengrades mehrere Inseln entdeckt mit tätigen Vulkanen, deren Ausbruch er beobachtete; an ihrer Existenz kann also kein Zweifel sein. Balleny ist dann auf dem 65. Breitengrad als erster nach Westen gesegelt, während alle seine Vorgänger sich vom Westwind nach Osten treiben liessen, und glaubt, vom 26. Februar bis 3. März, zwischen dem 131. und 118. Längengrad, mehrere Küsten gesichtet zu haben; dem am 3. März mit ziemlicher Bestimmtheit erkannten Landstrich hat er den Namen „Sabrina-Land“ gegeben. Balleny kann allerdings nicht beschwören, dass er wirklich Land sah, denn zu genauerer Untersuchung fehlt ihm die Zeit, wo keine Robben sind, kann er sich nicht aufhalten; es mag auch nur ein ungeheurer Eisberg und das Land dahinter Wolken gewesen sein; an den Balleny-Inseln aber ist nicht zu rütteln, und auch das Sabrina-Land hat sich seitdem auf den Karten der Antarktis behauptet, ohne dass seine wirkliche Existenz bis heute bewiesen ist. Auf der Rückfahrt ist der Kutter „Sabrina“ mit Mann und Maus untergegangen, aber Ballenys Bericht hat bei allen, die ihn kennen, die grösste Aufmerksamkeit erregt; im australischen Viertel der Antarktis ist augenscheinlich noch mehr zu finden als nur der magnetische Südpol.
Von Ballenys Erfolgen hört damals nur einer, der Führer der englischen Südpolexpedition, die man in Hobart erwartet, Kapitän Ross; wenige Tage vor seiner Abreise, Ende September 1839, erhält er diese wichtige Nachricht. D’Urville kann noch nichts davon wissen, aber bei den Andeutungen Biscoes spitzt er natürlich die Ohren. Hat der englische Kapitän auch den Befehlshaber der amerikanischen Expedition auf die Gegend südlich der Macquarie-Insel hingewiesen, so kann es zwischen der französischen Expedition, die dort unten zwischen 160 und 120° ö. L. arbeiten will, wo bisher nur Cook gewesen ist, und der amerikanischen zu einem unbequemen Wettlauf kommen; warum sonst ist Wilkes gerade in Sydney? Um so mehr Grund, die Abreise zu beschleunigen.
D’Urville versucht zunächst, auf dem Strich der geringsten Abweichung der Magnetnadel geradezu auf den magnetischen Südpol loszufahren, merkt aber bald, dass zu solch einem Seiltanz seine Instrumente nicht genau genug funktionieren. Auch sind Wind und Strömung ihm entgegen. Schon vier Tage nach der Abfahrt meldet der Arzt des „Astrolabe“ vier Kranke, die „Zelée“ hat schon sieben, und einer ihrer besten Matrosen stirbt. Todesursache: Ruhr! Die Seuche bricht aufs neue aus! Am 16. Januar signalisiert die Wache das erste Eis. All das weissagt nichts Gutes. Vor zwei Jahren zeigten sich die ersten Eisberge auf 59°, und die Expedition kam nicht bis zum 65. Diesmal ist sie auf 60°, und das schwimmende Eis ist schon so dick und bald auch so frisch, so wenig zerfallen, dass es erst kürzlich vom festen Lande, wo es gewachsen ist, abgebrochen sein muss. D’Urville fürchtet schon am 16., bald durch eine ebensolche Eismauer aufgehalten zu werden wie im Weddellmeer; dafür spricht auch die plötzlich auffallend ruhige See; diesmal wird die Eisschranke jedenfalls an dahinterliegenden Landstrecken ihren festen Stützpunkt haben. Wider Erwarten dringen die Schiffe am 18. Januar bis zum 64. Breitengrad vor, weit südlicher als Cook, der sich auf dieser ganzen Strecke oberhalb des 60. gehalten und mit dem Eis nirgends angebunden hat. Aber am Abend des 18. schwindet alle Hoffnung, noch weiter nach Süden zu gelangen; ungeheure Tafeleisberge, wie d’Urville sie nur bei den Süd-Orkney-Inseln, also in der Nähe festen Landes, gesehen hat, riegeln den Weg ab; sie bestätigen seine Überzeugung, dass in ihrem Rücken auch hier ein Landkern sein muss, von dem sie herkommen. Am 19. werden ihrer immer mehr, einer ist fast 2 Kilometer lang und so frisch, als sei er tags zuvor von Küstengletschern abgebrochen. Mehrmals schon hat die Wache durch Landmeldung die Besatzung in Aufregung versetzt, es sind immer nur dunkle Wolken über dem Horizont; am 19. aber sieht See-Ingenieur Dumoulin vom Mastkorb aus schwarzgraue Flecken, die deutlich hervortreten und bei längerer Beobachtung unverändert bleiben; er selbst wagt noch kaum an seine Entdeckung zu glauben und muss sich erst durch den Jubel der andern und ihre scharfen Augen von der Wirklichkeit des Gesehenen überzeugen lassen. Die Schiffe sind auf dem 66. Breitengrad, und die Mannschaft, deren Gesundheit sich sehr gebessert hat, bereitet schon ein Fest vor zur Überschreitung des Polarkreises, der nur noch ½ Grad entfernt ist. Aber bis dahin soll die Expedition nun einmal nicht kommen. Am Morgen des 20. zählt d’Urville 72 Eisberge ringsum, obgleich sich infolge Windstille die Schiffe über Nacht kaum von der Stelle bewegt haben, und diese Eismassen sind merkwürdig zerfallen; Bäche rieseln und stürzen von den ausgehöhlten Wänden wie Kaskaden ins Meer. Im Süden aber steht immer noch das gestern gesichtete Land, vom Strahl der hellen Morgensonne beleuchtet; es erstreckt sich von Osten nach Westen, ist ganz mit Schnee bedeckt und fällt gegen das Meer langsam ab; nirgends zeigt es einen Gipfel, nicht einmal einen dunklen Punkt, wo Felsen zutage treten, aber an seiner Existenz zweifelt heute niemand mehr. Obendrein meldet jetzt auch Kapitän Jacquinot, dass man auf der „Zelée“ seit gestern schon Land beobachte. Jetzt mögen die Matrosen feiern! Zwar nicht die Erreichung des Polarkreises, aber die Entdeckung eines unbekannten Erdstrichs in der Antarktis. Wenn nur endlich die Windstille vorüber wäre! Am 21. erst bringt eine leichte Brise die Schiffe näher heran; sie steuern zum zweitenmal durch enge Kanäle wie durch die Strassen einer Riesenstadt, von deren Marmorwänden die Kommandorufe eigentümlich hohl wiederklingen, und sehen plötzlich wieder offenes Wasser vor sich, das zwischen der Reihe schwimmender Eisberge, durch die sie sich glücklich durchgeschlängelt haben, und der Küste wie ein breiter Kanal nach Westen führt. Das Festland liegt nun mit aller Klarheit vor ihnen, eine einförmige, bis zu 1200 Meter ansteigende Ebene, ohne Bergrücken und Gipfel. Hier und da zeigt sich so etwas wie Dünen am Meeresstrand, es sind vom Schmelzwasser ausgehöhlte Schluchten; den Strand aber bildet eine hohe, schroffe Eiswand, die jede Landung unmöglich macht; davor liegt, wie eine drohende Postenkette, obendrein eine Masse kleiner und grosser Eisberge, die anscheinend noch festen Boden unter den Füssen haben, und nur darauf warten, von Strömung und Wind nach Norden getrieben zu werden.
Читать дальше