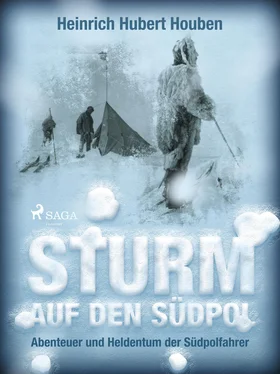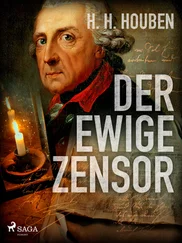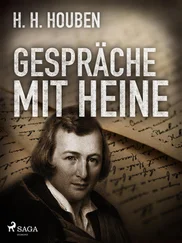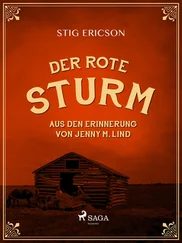Noch sind zwei Fahrstrecken Weddells weiter im Osten zu untersuchen. Offiziere und Mannschaft werden ja bezeugen müssen, dass schlechterdings nirgends ein Durchbruch nach Süden möglich war. Am 3. Februar kreuzen die Schiffe auf 55° 34′ s. Br. und 43° 32′ w. L. den dritten Weg; am selben Tag vor fünfzehn Jahren ist Weddell hier vom 65. Grad her zurückgekehrt. Und wieder dehnt sich hier offenes Meer bis zum südlichen Horizont! Auch am 4. weit und breit kein Eis! Die Matrosen jubeln: diesmal muss es gelingen! Aber ihr Führer hat alle Hoffnung aufgegeben. „Die Matrosen fürchten sogar, ich möge nicht weit genug vordringen“, schreibt er in sein Tagebuch; „sie dürfen ruhig sein, denn wenn ich umkehre, wird keiner mehr Lust haben, den Weg fortzusetzen.“
Noch am Abend des 4. ertönt wieder der Ruf der Wache: „Eisfeld in Süd!“ Es ist die Fortsetzung der schon gesehenen Eismauer, die sich immer weiter nach Osten hin erstreckt — d’Urville fährt darauf zu. Bald zeigt sich zur Linken ebenfalls eine Eismauer. Gerät er wieder in eine Sackgasse? Am liebsten kehrte er um, aber er fürchtet den üblen Eindruck auf die Mannschaft, die überzeugt ist: hier werde sich ein Durchgang finden. In gewissen Lagen, meint er, müsse der Führer seine eigene Meinung dem allgemeinen Wunsch opfern, selbst auf die Gefahr hin, sich ins Unglück zu stürzen. Zum drittenmal steuern die Schiffe in das wogende Packeis hinein, das hier von Robben belebt ist, die wie ungeheure Blutegel auf den Schollen liegen. Eine Weile geht es gut, aber die Eissägen am Scheg der beiden Schiffe werden abgerissen. Dichter Schneefall macht alle Bewegung unmöglich. D’Urville lässt die Schiffe an einem Eisberg festmachen, ein waghalsiger Versuch, den bisher noch kein Seefahrer hier unten gemacht hat. Die Tollkühnheit begeistert Offiziere und Matrosen. Dem Kommandanten aber ist dabei nicht wohl zumute. In der Nacht weckt ihn ein Poltern und Stossen gegen die Schiffswände, es kracht, als ob die Planken abrissen! Er stürzt auf Deck: der Wind ist umgesprungen, der „Astrolabe“ ist abgetrieben, das ganze Eis in Bewegung, die „Zelée“ ebenfalls wehrlos in seiner Gewalt. Eis ringsum, nur im Norden blinzelt hinter einem breiten Eisgürtel ein bläulich-schwarzer Streifen offenen Meeres. Dort allein ist Rettung! Jetzt beginnt ein Kampf ums Leben. „Astrolabe“ dringt wie ein Sturmbock nach Norden vor, ein paar Schiffslängen bricht er sich Bahn, dann steht er unbeweglich. Die Matrosen klettern aufs Eis hinunter, verankern eine Strecke vor seinem Bug die stärksten Taue an schweren Eisblöcken und ziehen so das Schiff langsam, unsagbar mühsam, vorwärts. Die „Zelée“ macht den gleichen Versuch. Es wimmelt hier von Robben, und der Jagdeifer macht trotz der drohenden Gefahr die Mannschaft halb verrückt. D’Urville kommandiert eine kleine Jagdabteilung ab, um wenigstens einige dieser Tiere für seine Sammlung zu erbeuten. Da sie sich gegen seinen Befehl vom Schiff entfernte und mit einem Boot geholt werden muss, darf keiner mehr das Deck verlassen. Auf der „Zelée“ derselbe Vorgang: ihr Boot mit etlichen Robbenjägern muss über die Eisschollen zum Schiff zurückgeschleppt werden; sie kommen halb tot, mit blutenden Händen, an Bord. Als sich beide Schiffe bis auf ein paar hundert Meter ans offene Wasser herangearbeitet haben, treibt ein plötzlicher Nordsturm sie wieder ins Eis zurück. Sie drehen und wenden sich hierhin, dorthin — kein Ausweg. Am nächsten Tag wird der Versuch, nach Norden durchzubrechen, wiederholt. In zehn Stunden rücken sie keine zwei Kilometer vor. Ein Mann geht auf Kundschaft drei Kilometer übers Eis; was er berichtet, ist niederschmetternd: das offene Wasser ist heute viel weiter entfernt als gestern, und am Rande des Eisfeldes ist eine Brandung, dass die Schiffe durch dieses Chaos unmöglich durchkommen. Ohne rettenden Wind ist die Expedition zum Untergang verurteilt, denn zu einer Überwinterung ist sie nicht ausgerüstet. Am Abend des 6. Februar wird d’Urville aus dem ersten Schlaf geweckt: ein Südwind hat das Eis gelockert und treibt die Schiffe langsam nach Norden! Der Kommandant will sofort unter Segel gehen, aber die Leute fürchten die Nachtfahrt, und er lässt sich von den Offizieren bestimmen, bis Tagesanbruch zu warten. Ein unseliger Entschluss! Um 3 Uhr wird geweckt. „Wie steht es mit dem Eis?“ ist d’Urvilles erste Frage an den wachthabenden Offizier. — „Wie gestern abend!“ Der Steuermann bestätigt die Nachricht. Der Wind ist um Mitternacht nach Norden umgesprungen, das Eis fester zusammengekeilt als gestern! Jetzt erfassen auch die Matrosen, dass sie durch ihren Nachtschlaf vielleicht ihr Leben verspielt haben. Das einzige, was sich tun lässt, ist, Schiff und vor allem Steuerruder gegen den Anprall der Eisschollen zu schützen. So vergeht der 7., der 8. Februar. Am Morgen des 9. weht ein leichter Wind aus Südost; die Schiffe machen sich sofort segelfertig. Zum drittenmal beginnt die mörderische Arbeit des Taueverankerns und Ziehens. Der Wind unterstützt sie. Am Nachmittag ist das offene Meer kaum mehr 600 Meter weit. Das Eis beginnt sich zu lockern, der Südwind frischt auf. „Taue einziehen! Alle Mann an Bord!“ Der „Astrolabe“ beginnt sich wieder zu bewegen, der Wind bläht die Segel. Der Kommandant atmet auf. Plötzlich Geschrei an Bord und verzweifeltes Rufen von draussen! Ein Mann ist noch auf dem Eis zurückgeblieben! Er rennt und springt über die Schollen, über Wasserrinnen, muss Umwege machen, stürzt, rafft sich wieder auf — niemand kann ihm helfen! Wenn er’s nicht schafft, ist er verloren — der Wind treibt das Schiff trotz aller Gegenbemühungen vorwärts —, und wenn es erst im freien Wasser ist, kann es nicht zurückkehren und noch einmal das Schicksal aller Kameraden aufs Spiel setzen! Die „Zelée“ ist weit entfernt und kann ihn ebensowenig retten. Furchtbare Augenblicke! Die Todesangst ist ein starker Motor. Der Unglückliche ist endlich so nahe heran, dass man ihm ein Tau zuwerfen und ihn heraufhissen kann. Er ist mehr tot als lebendig und ein volles Jahr lang ein kranker Mann. Wenige Stunden später sind die Schiffe aus dem Eis heraus und wieder Herr ihrer Bewegungen. Einen Teil ihres Kupferpanzers hat das Packeis weggerissen. Sonst aber sind sie noch völlig seetüchtig, und in einen Kampf mit dem Packeis wird ihr Kommandant sie nicht noch einmal führen.
Noch ist die Aufgabe der französischen Expedition nicht erfüllt; der vierte Weg weiter im Osten, auf dem Weddell bis zum 74. Grad hinuntergefahren ist, bleibt noch zu untersuchen. Die tollkühne Begeisterung der Mannschaft ist sehr abgeflaut. Die „Zelée“ hat einen Kranken, der „Astrolabe“ aber zehn, darunter die drei Ärzte! Die Leute stecken die Köpfe zusammen; die Ärzte hüllen sich in Schweigen. In respektvoller Entfernung von der Eismauer, die kein Ende zu nehmen scheint, segeln die Schiffe weiter gen Osten. Ungeheure Schneemassen rieseln nieder, alle Stunden müssen sie ins Meer geschaufelt werden, und die Leute frieren entsetzlich. Ein Glück noch, dass diese barbarische Kälte nicht zwei Tage früher ausbrach, dann hätte es kein Entkommen aus dem Eis gegeben! Am 14. Februar endlich ist der 33. Längengrad erreicht. Auch hier ist weder nach Süden noch nach Osten durchzukommen, denn die Eismauer bildet abermals eine gewaltige Bucht und läuft dann nach Norden, so weit das Auge reicht. Und hier will Weddell offenes Meer gefunden haben? Unmöglich! So viel steht jedenfalls fest, dass im Polarsommer 1837/38 dieser Meeresteil nach Süden hin durch unermessliche Eismassen völlig gesperrt ist. Das war zu beweisen, und mehr ist nicht zu tun.
Kapitän Jacquinot kommt an Bord des „Astrolabe“. Er ist ganz der Meinung des Führers: jeder weitere Versuch ist Unsinn, und von der Besatzung ist keiner lüstern auf einen neuen Kampf mit dem Packeis. Aus den versprochenen Belohnungen wird nun zwar nichts werden, die Leute witzeln schon darüber. Die meisten von ihnen, selbst einige Offiziere, sind merkwürdig matt; der Kranke auf der „Zelée“ wird wohl sterben. Salz- und Büchsenfleisch widert sie alle längst an, schon seines abscheulichen Geruchs wegen. Robben fanden sich bisher nur in den gefährlichsten Tagen mitten im Eis; den Wert ihres Fleisches für die Gesundheit der Mannschaft scheinen weder die Ärzte noch der Führer zu kennen.
Читать дальше