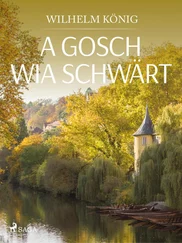Ich werde schon sehen, sagte der Schäfer, der Hund werde es sich merken und mich schon nochmal packen.
Und die Leute, die jetzt aus den Häusern gekommen waren und herumstanden, zusammen mit den Kindern, die sich nun wieder auf die Bahn trauten, glaubten das auch.
Ja, ja, sagte ich nur.
Aber der Hund machte nichts; er ging mir immer aus dem Weg, wenn er mich nur kommen sah.
Ich hab auch, ehrlich gesagt, nichts anderes erwartet; mit den bloßen Händen wäre ich ihm an die Gurgel gefahren.
Ich mochte ja Hunde gern, aber nicht solche, die gegen mich oder andere Kinder gingen. Da wird sich auch nichts ändern. Einige Jahre später habe ich mit einem solchen Schäferhund oder Wolfshund regelrecht Freundschaft geschlossen. Das war auf einem Hof in Oberschwaben, auf einem sehr großen Hof, so wie es bei uns im mittleren Württemberg keine gab, wo wir meinen Vater nach dem Krieg besucht haben. Er mußte hier als Knecht arbeiten in der Zeit, in der ihn die Franzosen gefangengesetzt hatten. Eigentlich waren es drei Hunde; der eine an der Haupteinfahrt von der Straße her, der andere hinten heraus zum Teich, und der dritte rechts bei den Pferdeställen und den Knechtwohnungen darüber.
Ich verstand mich mit allen dreien, aber am besten mit dem an der Haupteinfahrt. Er war in einem großen Käfig drin und sprang sofort zähnefletschend am Gitter hoch, wenn sich ein Fremder ihm nur näherte.
Das machte mich natürlich neugierig.
Nicht, daß ich ihn reizen oder herausfordern wollte: der Hund gefiel mir halt. Es war auch ein schönes Tier.
Schon am Morgen, gleich nach dem Kaffee, ging ich raus und stellte mich vor den Käfig und sprach mit ihm. Am zweiten Tag bellte er schon nicht mehr, wenn ich kam, knurrte nur noch und drehte sich weg. Schließlich gab er auch das Knurren auf und blieb stehen und drehte sich nicht mehr von mir weg.
Dann fragte ich den Bauern, ob ich mit dem Hund Spazierengehen dürfte – ich meine mit dem Harras, mit dem im Käfig an der Hauptein- und -ausfahrt? Ja, sagte er, wenn ich meinte; der Hund brauche schon wieder einmal Bewegung. Ich solle aber vorher nochmal mit ihm schwätzen, das heißt ihn füttern und so Sachen. Das tat ich auch; und jetzt winselte Harras schon, wenn er mich kommen sah. Ich ließ mir den Schlüssel zum Schloß an der Tür des Hundekäfigs geben und führte ihn heraus, und der Hund folgte mir, so als kannten wir uns schon ewig.
Ich rannte mit ihm über Äcker und Wiesen, an hohen Maisfeldern vorbei; ich warf einen Stock voraus und hetzte ihn hintendrein. Wir kamen auch zu dem Teich hinter dem Hof; das Wasser war nicht sauber. Trotzdem spuckte ich auf meinen Briegel, Harras sprang hinein und brachte ihn mir wieder – er war batschnaß, und ich wurde in diesen Tagen, wo wir meinen Vater auf dem Hof besuchten, auch nicht mehr sauber.
Es waren schöne Tage in Oberschwaben. Nicht nur wegen Harras. Auch wegen dem Essen und wegen der Milch, die es da gab: mehr als wir in dieser Zeit zu Hause hatten.
Mein Vater mußte auch Kühe melken und misten. Ich stand mit ihm in aller Herrgottsfrühe auf, half ihm oder schaute ihm nur zu. Dann melkte er einen steinernen Literkrug warmer Kuhmilch voll; ich setzte an und trank, bis mir der Bauch platzen wollte. Aber mein Vater sagte: trink nur.
Beim Essen am Tisch sagte meine Mutter: iß, und ich aß. Da saßen meine Mutter und ich allein mit dem Bauern und seiner Familie zusammen. Mein Vater mußte bei den anderen Gefangenen, den Knechten und Mägden bleiben.
Als an dieses Ende noch nicht zu denken war, erzählte mir mein Vater, daß sie in dem Lager – Mauthausen und, vor dem Krieg, Heuberg auf der Schwäbischen Alb –, wo er als Bewacher eingesetzt war, auch Hunde hätten. Auch Deutsche Schäferhunde; lauter schöne Tiere.
Ob die denn auch gegen Kinder gingen, fragte ich ihn einmal.
Die gingen gegen alles, sagte er, wenn man sie draufhetzt; die seien alle dressiert.
Dressiert? Auf was dressiert?
Auf Menschen; auf Juden, Zigeuner, Kommunisten . . .
Ich solle nicht so viel fragen, sagte mein Vater.
Na gut; er mußte es wissen.
Auf mein erstes Fahrrad mußte ich sehr lange warten. Im Haus – genauer gesagt: im Schopf – gab es nur einen alten, verrosteten Rahmen mit zwei Rädern. Aber keine Schläuche und keine Mäntel; die waren in dieser Zeit auch nirgends zu bekommen. Auch die Kette fehlte.
Ein Mann, der immer im Haus und auf den Feldern half, gab mir mal den Rat, ich solle doch Seile in die Felgen legen und damit herumfahren; aber das ging nicht. Das Seil mußte ja zusammengemacht werden, und der Knopf war nachher viel zu dick, so daß sich das Rad mit den Seilern gar nicht erst durch die Gabel drehen ließ.
Trotzdem konnte ich Fahrrad fahren und durfte ich Fahrrad fahren. Einmal mit dem Fahrrad – einem Herrenfahrrad – eines Mannes, der bei uns zu Besuch war. Ich kannte ihn nicht, und auch meine Mutter kannte ihn offenbar nicht; aber er stand eines Tages vor der Haustür und sagte, daß er etwas zu Essen und zu Trinken haben wolle, er würde auch dafür etwas arbeiten.
Er blieb zwei oder drei Tage bei uns – ein Schaffer war er nicht, er hatte offenbar vorher noch nie geschafft, das sah man sofort, so wie er eine Mistgabel, eine Schaufel oder einen Rechen in die Hand nahm – von einer Axt oder einem Beil zum Holzspalten ganz zu schweigen; da bekam sogar ich Angst! Aber er hatte ein Fahrrad, und er ließ mich damit fahren. Natürlich reichte ich noch nicht auf den Sattel; ich trat seitlich, unterhalb der Lenkstange die Pedale. Das ging ganz gut, und ich flog damals auch nicht mehr hin wie später mit dem eigenen Fahrrad und richtig im Sattel sitzend und von oben her treppelnd.
Gewisse Dinge waren im Krieg einfach nicht zu kriegen. So ging es mir auch mit dem Fußball; einen echten Lederball hatte ich endlich bekommen, aber es fehlte mir die Blase dazu. Ich klapperte ein Geschäft und eine Sattlerei nach der anderen ab, in unserem Ort und in der Umgebung. Ich war tagelang unterwegs – aber eine richtige Gummiblase fand ich nicht!
So behalf ich mir dann mit einer Sauenblase, damit blieb doch eine Zeitlang die Luft im Ball, und man konnte damit kicken. Ich war sehr stolz darauf, und die Kinder folgten mir wie ein Hund, wenn ich nur mit dem Ball irgendwo auftauchte.
Wie gern wäre ich bei der Hitlerjugend gewesen; die hatten so schöne Halstücher, Hemden und Hosen, Gürtel und Dolche. Ich hatte nur mein Holzgewehr und die Pickelhaube – ja, und den Gürtel! Aber das war doch nichts im Vergleich zu den Gürteln der Hitlerjugend.
Die machten so schöne Geländespiele, zündeten Feuer an, hockten sich drum herum und sangen.
Aber wenn ich einmal ein Feuer im Wald machen würde, dann würde es gleich heißen, der Wald brennt. Und einmal hat es auch gebrannt – nicht im Wald und nicht, weil ich gezündelt hatte –, sondern davor. Der Brandstifter hieß Franz Kerz; er hatte, so wie das auch andere machten und gemacht haben, im Frühjahr das dürre Gras unterhalb des Waldes angesteckt. Dann wurde das Feuer immer größer, erfaßte einige Büsche und griff auch in den Wald über.
Aber da war schon die Feuerwehr alarmiert und die ganze Bevölkerung: die zog – Kind und Kegel, Herr und Hund – den Hang hinauf. Denn es hieß: der Wald brennt – der Kerz hat den Wald angezündet! Aber es war nicht der ganze Wald – den hätte einer allein nicht anzünden können, so groß ist der um unser Dorf in dem Tal herum.
Bei der Hitlerjugend hat der Wald nie gebrannt, und wenn nachts die Flammen noch so hochschlugen. Das war etwas anderes, und da waren ja auch ältere Leute dabei als Führer. Ich hätte da sehr gern mitgemacht. Aber ich war noch zu jung – und dann wollte man mich auch nicht!
Wenigstens eine Uniform hätte man mir schenken können – vielleicht bekam ich noch eine, oder ich stahl mir eine. Meine Mutter nähte Uniformen – Soldatenuniformen – für ein Geschäft in der Nachbarstadt. Sie machte Heimarbeit; sie nähte die Knöpfe an die Kittel und an die Hosen – nur die Knöpfe: die Uniformen wurden gebracht und wieder abgeholt. Da hätte man keine wegnehmen können; die wurden alle genau gezählt.
Читать дальше