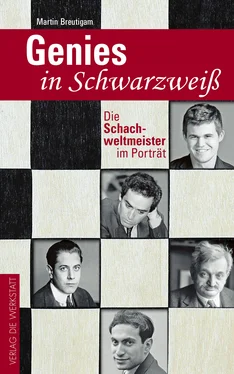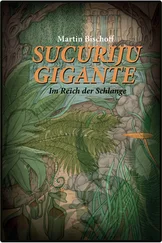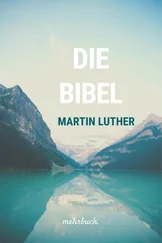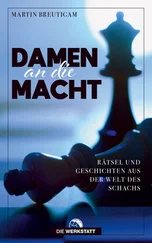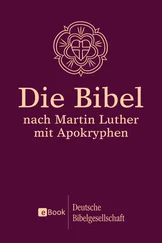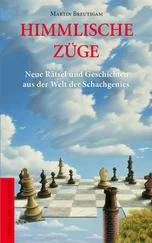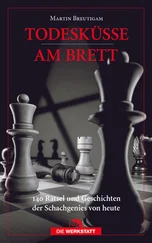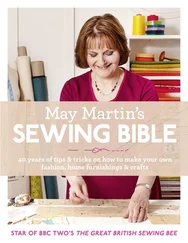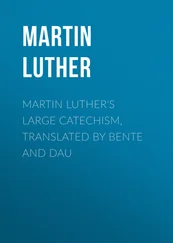En passant
Spielte Lasker psychologisch?
Gilt Wilhelm Steinitz bis heute als Vater des positionellen Spiels, so wird Lasker zugeschrieben, die Thesen des von ihm geschätzten Steinitz weiterentwickelt und die Psychologie ins Turnierschach eingeführt zu haben. Letzteres hält Großmeister Dr. Robert Hübner allerdings für eine Legende, die er in verschiedenen Aufsätzen zu widerlegen versuchte. Die von jeher bekannte Behauptung, Lasker habe mitunter absichtlich schwächere Züge gewählt, um seine Gegner zu verwirren, ist laut Hübner absurd. Und die Tatsache, dass Lasker manchmal, etwa bei der Wahl der Eröffnung, die Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners berücksichtigte, sei nicht psychologischer, sondern schachtechnischer Natur.
Tatsächlich haben wohl eher Laskers Bewunderer und Gegner mit der Legende von der „psychologischen Spielweise“ seine gewaltigen Erfolge zu erklären versucht. In Laskers eigenen Schriften finden sich kaum derartige Hinweise. Doch er selbst erklärte interessanterweise den Stil seines Vorgängers Steinitz „psychologisch“, und zwar im Lehrbuch des Schachspiels: „Er [Steinitz] wollte, dass seine Gegner auf Gewinn spielten, also gab er ihnen einen Vorwand dazu, eine Ausrede dafür, zumindest einen Anreiz dazu, indem er sein Streben, von vornherein nicht auf Gewinn zu spielen, allzu deutlich machte und sich öfter zu bizarren Zügen hinreißen ließ. Dieser Vorgang war sicherlich im Bezirk des Unterbewussten, auch lag dafür keine logische Notwendigkeit vor, aber wirkte sich psychologisch bei Steinitz so aus.“
Schachpsychologie hin oder her – der Einfluss des Zeitgenossen Sigmund Freud ist unverkennbar.
Lasker ist besiegt
Im Sommer 1920 verzichtete Lasker in einer offiziellen Erklärung auf seinen WM-Titel zugunsten des Kubaners José Raoul Capablanca. Dieser hatte ihn neun Jahre zuvor herausgefordert. Doch ein Wettkampf war nicht zustande gekommen. Zunächst hatte man sich nicht auf die Bedingungen einigen können, dann war der Krieg dazwischengekommen. Und als man sich 1920 wieder zusammensetzte und endlich einigte, war die Finanzierung ungewiss. Laskers Verzicht stieß allerdings auf allgemeine Ablehnung. Kurz darauf wurden doch noch genügend Sponsoren gefunden. Havannas ruhmreicher Schachklub sprang ein, so dass Laskers Honorarforderung (11.000 Dollar) akzeptiert werden konnte und sich beide im März 1921 gegenübersaßen.
Dem 52-jährigen Lasker machte die tropische Hitze in Kuba offenbar mehr zu schaffen als seinem 20 Jahre jüngeren Gegner: Nach 14 der eigentlich angesetzten 24 Partien gab Lasker auf. Vier Partien hatte er verloren, zehn remisiert, keine gewonnen. Die Frage, ob Lasker an einem anderen Ort besser ausgesehen hätte, ist durchaus berechtigt.
Die Karriere mochte sich dem Ende zuneigen, sein vielleicht größtes Turnierresultat stand jedoch noch bevor. Beim Weltklasseturnier in New York 1924 ließ der fast 56-Jährige noch einmal alle hinter sich. Lasker gewann mit formidablen 16 Punkten aus 20 Partien, vor Weltmeister Capablanca (14,5) und Alexander Aljechin (12). Auch in Moskau 1925 landet Lasker als Zweiter (hinter dem Sieger Efim Bogoljubow) vor Capablanca. Er war nicht nur 27 Jahre lang Weltmeister gewesen, sondern auch drei Jahrzehnte lang der weltbeste Turnierspieler.
Danach zog sich Lasker für längere Zeit vom Turnierschach zurück. In seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf und in seinem Sommerhaus in Thyrow bei Berlin fand er nun Zeit für seine anderen Leidenschaften, etwa für die Spiele Go und Bridge. Lasker erfand auch ein eigenes Spiel, das er Lasca nannte. Und er publizierte weiterhin: Mitte der 1920er Jahre waren Gesunder Menschenverstand im Schach , die deutsche Ausgabe von Common Sense in Chess , sowie Vom Menschen die Geschichte erschienen, ein zusammen mit seinem Bruder Berthold verfasstes Drama. Das Lehrbuch des Schachspiels kam 1926 heraus. Welch pralles Leben! Lasker der Weltmeister. Lasker der Mathematiker, der Philosoph, der Schriftsteller, der Dramatiker.
In Wilmersdorf wohnte Lasker in der Aschaffenburger Straße 6a, zweiter Stock. Wer heute seinen Spuren folgt, bekommt eine Ahnung davon, welch vielfältiges kulturelles Leben aus Berlin verschwand. Bevor die Nazis 1933 an die Macht kamen, lag hier ein Kiez des Geistes; nur eine Straße weiter wohnte Albert Einstein. Und 20 Fußminuten entfernt befand sich das Romanische Café, dort war Lasker Stammgast, ebenso Bertolt Brecht, Otto Dix, Erich Kästner und viele andere, auch jüdische Künstler und Intellektuelle. Am Ort des Romanischen Cafés steht heute das Europa-Center. Auch das Haus in der Aschaffenburger Straße 6a wurde im Krieg zerstört.

Emanuel Lasker im Alter von 60 Jahren
Als die Nazis die Macht übernahmen, sahen Lasker und seine Frau Martha für sich in Deutschland keine Zukunft mehr. Sie mussten ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen. Harte Jahre der Emigration standen bevor. Zunächst flohen sie in die Niederlande. Ein Jahr danach zogen sie weiter nach London und später nach Moskau. Der materiellen Not gehorchend, nahm Lasker wieder an Turnieren teil – mit erstaunlichen Erfolgen wie etwa beim großen Turnier in Moskau 1935: Im Alter von 66 Jahren wurde er Dritter, hinter Salo Flohr und Michail Botwinnik, aber vor Capablanca. Schließlich kehrte Lasker auch der Sowjetunion den Rücken und ließ sich von 1938 an wieder in New York nieder, wo er am 11. Januar 1941 in ärmlichen Verhältnissen starb. Seine letzten Worte waren laut Martha Bamberger: „König des Schachs.“
José Raoul Capablanca
Ein Gentleman aus Havanna

Wie Capablanca auftrat, spielte er auch: erhaben, selbstbewusst, intuitiv und mit einer unverwechselbaren Klarheit.
Der sowjetische Stummfilm Schachfieber , gedreht während des legendären Turniers in Moskau 1925, gibt einen tragikomischen Einblick in die Leiden einer Frau, die sich auf einen Schachverrückten eingelassen hat: Ihr angehender Ehemann, dessen Innenleben sich von seiner Socke bis zum Teppich in einer schwarzweiß karierten Außenwelt widerspiegelt, ist offenbar so sehr mit einem komplizierten Schachproblem beschäftigt, dass er die wartende Hochzeitsgesellschaft vergisst. Aus der Trauung wird natürlich nichts, weswegen die verzweifelte Braut untröstlich und aufs Schach nicht gut zu sprechen ist. Ausgerechnet in diesem Augenblick läuft ihr ein gutaussehender Gentleman über den Weg, der die Unglückliche schließlich wieder zum Lachen bringt und sie sogar – an dieser Stelle vermischt sich der Film mit der Wirklichkeit – zu einem Besuch des großen Schachturniers überreden kann.
Den besagten Gentleman spielte José Raoul Capablanca, der dritte Weltmeister der Schachgeschichte. Er mimte im Grunde sich selbst. Denn einerseits wurde Capablanca für seine vornehmen Manieren gerühmt, andererseits sorgte die allseits beträchtliche Zahl seiner Anhängerinnen für Aufsehen. Und wie er auftrat, spielte er auch Schach: erhaben, selbstbewusst, intuitiv und mit einer unverwechselbaren Klarheit. Lediglich 35 Niederlagen musste Capablanca in seiner gesamten Karriere hinnehmen, in seiner stärksten Zeit, zwischen 1916 und 1924, verlor er keine Turnierpartie. „Was andere in einem Monat nicht entdeckten, sah er auf den ersten Blick“, sagte der amerikanische Großmeister Reuben Fine.
Mit vier den Vater besiegt
Dieses außergewöhnliche Talent war früh sichtbar geworden. Capablanca wuchs in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Mit vier Jahren erlernte er die Schachgrundlagen, indem er seinem Vater beim Spielen zusah. Noch im gleichen Alter soll er ihn erstmals besiegt haben. Es war das Jahr 1892, damals spielten Steinitz und Tschigorin in Havanna um die Weltmeisterschaft, ein Ereignis, das ihn geprägt habe, erklärte Capablanca später.
Читать дальше