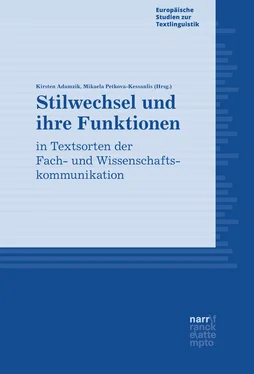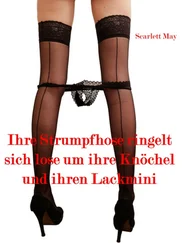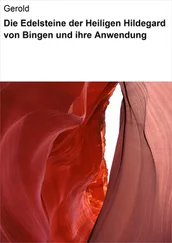Ein weiteres Kennzeichen zunehmender Didaktisierung von Fachstilen ist ein Frequenzanstieg in der Nutzung des Handlungsmusters Simplifizieren. Auch dabei könnte man geneigt sein, Vereinfachungsstrategien hauptsächlich auf die Qualität der vermittelten grammatischen Substanz zu beziehen, gemeint ist aber das Bemühen um eine der Rezipientengruppe entsprechende Formulierungsweise (z.B. im Sinne grammatischer und semantischer Komplexität) mit angemessenem Grad an Fachsprachlichkeit. Die folgenden Beispiele zur grammatischen Kategorie „Modus“ (Indikativ) zeigen, dass im Vergleich der zugrunde gelegten Grammatik-Texte erkennbar Komplexitätsreduktion erfolgt: Die an Erwachsene adressierte kleine Duden-Grammatik (vgl. Hoberg/Hoberg 2016: 6 [Vorwort]) weist, wie zu erwarten, komplexere grammatische Strukturen auf als beispielsweise der Schülerduden. Dort finden sich wesentlich mehr Beispielsätze zur Illustration, die dazu dienen sollen, die Verstehbarkeit der abstrakten Ausführungen zu gewährleisten, für die Erwachsenen-Zielgruppe dagegen wird der Bedarf an Beispielsätzen geringer eingeschätzt, wie die folgenden längeren Belege verdeutlichen:
(30) Der Indikativ (die Wirklichkeitsform) ist der neutrale Modus, die Normalform sprachlicher Äußerungen, von der sich die spezifischen Modi Konjunktiv und Imperativ abheben.Der Indikativ stellt einen Sachverhalt als gegeben dar. Das muss nicht bedeuten, dass es sich um ein reales, tatsächliches Geschehen handelt. Auch „unwirkliche“ Begebenheiten (etwa in Träumen oder Märchen) werden im Indikativ formuliert, wenn sie für den Sprecher Geltung haben, z.B.:Ich stürzte in ein tiefes schwarzes Loch (– und wachte auf). (Hoberg/Hoberg 2016: 128)
(31) Der Indikativ ist der neutrale Modus des Verbs. Von ihm heben sich die anderen Modi ab. Man gebraucht ihn vor allem, um etwas ohne irgendwelche zusätzliche Schattierungen darzustellen:Stockholm ist die Hauptstadt von Schweden. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet . He, du stehst auf meinem Fuß!Der Indikativ kann nicht nur in Aussagen, die sich auf Wirkliches beziehen, gebraucht werden. Man kann mit ihm auch Pläne oder Fantasievorstellungen möglichst neutral darstellen: [zwei Beispielsätze zur Illustration]Der Indikativ kann aber auch zum Ausdruck von (eher unfreundlich gemeinten) Aufforderungen verwendet werden […]. (Dudenredaktion 2017: 78)
(32) Indikativ ( du kommst ) ist der neutrale Modus des Verbs, der am häufigsten anzutreffen ist. (Habermann u.a. 2015: 16)
(33) Der Indikativ ist die Normalform sprachlicher Äußerungen. Er drückt aus, dass ein Sachverhalt gegeben ist.Ein Tag hat 24 Stunden.Rom ist die Hauptstadt Italiens.(Steinhauer 2015: 7)
Wie erkennbar, ist neben geringerer grammatischer und semantischer Komplexität mit geringerem Grad an Fachsprachlichkeit das Exemplifizieren eine wesentliche Realisierungsmöglichkeit für das Simplifizieren: die Illustration und das Erläutern von Sachverhalten an nachvollziehbaren Beispielen, die für den Nutzer Erkenntnisgewinn und Souveränitätszuwachs ermöglichen und ihm die Übertragung auf andere sprachliche Äußerungen erleichtern sollen. Dabei fällt auf, dass sich die Textproduzenten auch bei der Auswahl und Gestaltung der Beispiele in Teilen an der Lebenswelt und am Alter der Rezipienten orientieren: So beziehen sich etwa die Beispielsätze für den Crashkurs Grammatik (Steinhauer 2015) häufig auf die Bereiche „Beruf“ und gelegentlich „Freizeit“:
(34) Substantivierte Verben sind als Substantiv gebrauchte Verben. Auch zusammengesetzte Verben können substantiviert werden.Das tägliche Arbeiten nervt mich sehr.Ich genieße das Zugfahren sehr.Das Sichgehenlassen im Urlaub ist nicht mein Ding.(Steinhauer 2015: 28)
In ähnlicher Art der Rezipientenorientierung finden sich im Schülerduden oft Beispiele aus der Lebenswelt von Schülern –
(35) Es gibt auch zusammengezogene Teilsätze . Im folgenden Beispiel ist der Hauptsatz (a) zusammengezogen:(a) Thomas rudert im Klub und hat trotzdem Zeugnisnoten,(b) die weit über dem Durchschnitt liegen . (Dudenredaktion 2017: 320)
– und es ist sicher kein Zufall, dass die Autoren bzw. der Verlag im Interesse des Attraktivmachens auch auf Beispiele aus „moderner Lyrik und Rap“ (Vermerk auf der ersten Umschlagseite) zurückgreifen.
3 Stilwandel im diachronen Vergleich zielgruppengleicher Grammatik-Darstellungen
Im Folgenden wird ein kursorischer Blick auf Stilwandelphänomene in der Grammatikschreibung bzw. Grammatikographie geworfen. Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, die als Duden-Grammatik erstmals 1959 erschienen ist und mittlerweile in 9. Auflage vorliegt, bietet dafür u. E. einen geeigneten Anknüpfungspunkt.1 Vergleicht man die bisher vorliegenden neun Auflagen, springen zunächst Veränderungen ins Auge, die den Umfang und das Layout betreffen: So hat sich der Umfang der Duden-Grammatik von ursprünglich knapp 700 Seiten auf aktuell 1.340 Seiten fast verdoppelt. In der Auflagenhistorie fällt außerdem insbesondere das Bemühen um Verbesserung der Übersichtlichkeit auf; dazu gehört, dass Gliederungs‑ und Aufzählungsverfahren leserfreundlicher gestaltet werden, dass – erkennbar schon seit der 3. (1973), verstärkt aber seit der 4. Auflage (1984) – Inhalte zunehmend mit Tabellen aufbereitet und dass typographische Hervorhebungen eingesetzt werden, dass ferner mit der 7. Auflage (2005) zweifarbiger Druck eingeführt worden ist und dass seit der 8. Auflage (2009) an zentraler Stelle, den Umschlaginnenseiten, Benutzungshinweise aufgenommen worden sind. Und auch die Modernisierung der Schriftart ist im Zusammenhang mit Gestaltungsstrategien zu sehen, die die Übersichtlichkeit und die schnelle Orientierung fördern und in Typographie und Layout einen rezipientenfreundlichen Eindruck hervorrufen sollen.
Dass erstmals mit der 4. Auflage ein Literaturverzeichnis Teil der Duden-Grammatik ist, kann als (vordergründiges) Zeichen des Anspruchs auf Wissenschaftlichkeit als Stilmerkmal interpretiert werden. Dieser Anspruch wird dadurch etwas relativiert, dass die angegebene Sekundärliteratur seit der 6. Auflage (1998) als „Auswahl“ bezeichnet wird, wenn auch – als Folge vermutlich auch der ‚Flut‘ an Forschungsliteratur zur deutschen Grammatik – die Zahl aufgeführter Referenzwerke stark angewachsen ist (von z.B. 157 Titeln in der 4. Auflage von 1984 und 159 Titeln in der 5. Auflage von 1995 auf 431 Titel in der 9. Auflage von 2016). Mag ein (anwachsendes) Literaturverzeichnis möglicherweise Wissenschaftlichkeit suggerieren, so verdeckt das allerdings etwas den Umstand, dass das für eine wissenschaftliche Arbeitsweise charakteristische und für das damit verbundene Erfüllen von Lesererwartungen vermutlich bedeutsamere Einarbeiten von und das Verweisen auf einschlägige Forschungsliteratur im Laufe der Zeit erkennbar reduziert worden ist. Auch darin allerdings kann man eine weitere Konsequenz aus dem Bemühen um rezipientenfreundliche Gestaltung für einen sehr breiten und nicht notwendigerweise mit Konventionen der Gestaltung von Wissenschaftstexten vertrauten Adressatenkreis erkennen.
Zu diesen ersten recht augenfälligen Befunden – Stärkung von Übersichtlichkeit als Stilmerkmal und quantitativ zwar zunehmendes (Literaturmenge), qualitativ aber abnehmendes (Zitate, Verweise usw.) Wissenschaftlichmachen in der textlichen Darstellung – kommt die mit dem Anspruch und zugleich Ausweis von Expertenschaft verbundene Angabe der jeweiligen Autorenteams, die in den Anfängen hinter der Angabe des leitenden Bearbeiters, später dann des verantwortlichen Dudenredakteurs bzw. der Dudenredaktion als Herausgeberin sichtbar werden:2
| Auflage |
Bearbeiter / Herausgeber |
Autorinnen und Autoren |
Zuständigkeit |
| 1 (1959) 2 (1966) |
Paul Grebe |
Max Mangold |
Der Laut |
| Dieter Berger |
Das Wort: Die Wortbildung |
| Helmut Gipper |
Der Inhalt des Wortes und die Gliederung des Wortschatzes |
| Rudolf Köster |
Das Wort: Wortarten |
| Paul Grebe |
Der Satz |
| Christian Winkler |
Die Klanggestalt des Satzes |
| 3 (1973) |
Paul Grebe |
Max Mangold |
Der Laut |
| Helmut Gipper |
Der Inhalt des Wortes und die Gliederung des Wortschatzes |
| Wolfgang Mentrup |
Das Wort: Die Wortarten (in Teilen) |
| Paul Grebe |
Der Satz |
| Christian Winkler |
Die Klanggestalt des Satzes |
| 4 (1984) |
Günther Drosdowski |
Max Mangold |
Der Laut |
| Gerhard Augst |
Der Buchstabe |
| Hermann Gelhaus |
Die Wortarten |
| Hans Wellmann |
Die Wortbildung |
| Helmut Gipper |
Der Inhalt des Wortes und die Gliederung der Sprache |
| Horst Sitta |
Der Satz |
| Christian Winkler |
Die Klanggestalt des Satzes |
| 5 (1995) 6 (1998) |
Günther Drosdowski bzw. Dudenredaktion |
Peter Eisenberg |
Der Laut und die Lautstruktur des Wortes, Der Buchstabe und die Schriftstruktur des Wortes |
| Hermann Gelhaus |
Die Wortarten |
| Hans Wellmann |
Die Wortbildung |
| Helmut Henne |
Wort und Wortschatz |
| Horst Sitta |
Der Satz |
| 7 (2005) 8 (2009) 9 (2016) |
Dudenredaktion bzw. Angelika Wöllstein / Dudenredaktion |
Peter Eisenberg |
Phonem und Graphem |
| Jörg Peters |
Intonation |
| Peter Gallmann |
Was ist ein Wort?, Grammatische Proben, Die flektierbaren Wortarten (außer: Das Verb), Der Satz |
| Cathrine Fabricius-Hansen |
Das Verb |
| Damaris Nübling |
Die nicht flektierbaren Wortarten |
| Irmhild Barz |
Die Wortbildung |
| Thomas A. Fritz |
Der Text |
| Reinhard Fiehler |
Gesprochene Sprache |
Die Übersicht macht die jeweilige (unterschiedlich umfangreiche) Zusammensetzung der Autorenteams und die Verteilung der Zuständigkeiten deutlich, außerdem ist erkennbar, wie sich die Struktur der Grammatik und der Zuschnitt einzelner Teile im Laufe der Zeit gewandelt hat. Abgesehen von in der Natur der Sache liegenden Veränderungen in der Zusammensetzung und Verantwortlichkeit (stellvertretend sei auf die konzeptionellen und darstellerischen Veränderungen des Wortbildungs-Kapitels im Übergang der Zuständigkeit von Hans Wellmann [4.–6. Auflage] zu Irmhild Barz [seit der 7. Auflage] verwiesen) ist hier vor allem das Bemühen um Kontinuität, aber auch die Erweiterung der Autorenteams bemerkenswert, da durch die damit verbundene Arbeitsteilung der Anspruch auf Expertenschaft zusätzlich bekräftigt wird.
Читать дальше