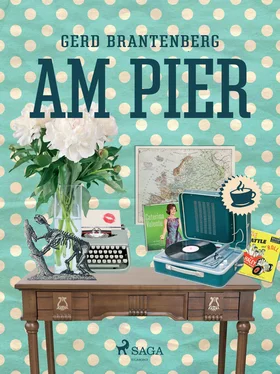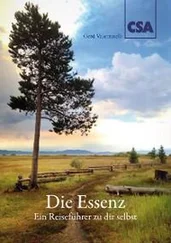„Ach? Wer ist das denn?“
„Der? Ach, einfach so ein Junge, natürlich.“
Wieder dachte Fräulein Halvorsen eine Weile nach. Seit vielen Jahren hatte alles dem Ziel gedient, ihre Tochter in die Gelbe Anstalt zu bringen. Nichts durfte dabei schiefgehen. Aber gleichzeitig wußte sie, daß sie jetzt nicht mehr von früh bis spät auf sie aufpassen konnte. Das mußte sie jetzt selber schaffen. Das tat weh.
„Heute gibt’s Erbsensuppe, Mädi.“
„Schön“, rief Beate. „Aber Mama, kannst du nicht anfangen, mich Beate zu nennen?“
Im kleinen Zimmer neben dem Wohnzimmer hatten sie ans Fenster neben dem Bett ein Tischchen gestellt. Hier konnte Beate hinter den Blumentöpfen sitzen und auf Kapellveien hinausblicken. Das Fenster war ziemlich niedrig, wenn Leute dicht vorbeigingen, konnte sie sie ungefähr von der Taille aufwärts sehen. Waren sie weiter entfernt, sah sie sie ganz. Es war schön, hinter dem kleinen Dschungel aus Topfblumen zu sitzen und einfach nur zu schauen. Auf dem Tisch lag ein großer neuer grüner Bogen Löschpapier als Unterlage, darauf Hefte und Kladden und ein kleiner hellgrüner Behälter für Bleistifte, Radiergummi und Bleistiftspitzer. Endlich hatte sie einen Ort für sich allein.
Beate fragte, ob sie keinen Vorhang haben könnte. „Wozu soll das denn gut sein?“ fragte Mama, und darauf hatte Beate nicht sofort eine Antwort. „Einfach so“, sagte sie.
„Ist denn das, was du jetzt machst, so schrecklich geheim?“ hakte Mama nach. „Ach, Mama, du könntest doch gut so einen Vorhang nähen. Das macht doch wohl nichts.“ – „Aber wozu soll das gut sein, frage ich?“ fragte Mama noch einmal. „Naja, nur so, nur so... es wäre schrecklich gemütlich, finde ich.“ – „Schrecklich gemütlich? Ich glaube nicht, daß sich das Zimmer gut machen würde mit einem Vorhang in der Mitte, Mädi. Dazu ist es nicht geschaffen.“ – „Macht es sich jetzt vielleicht gut?“ fragte Beate. Aber sie gab nach. Denn eigentlich hatte sie nicht daran gedacht, wie sich das Zimmerchen vom Zimmer aus machen, sondern wie es drin sein würde. Aber das schien Mama nicht zu begreifen.
In diesen Zimmern hatten sie und ihre Mutter immer gewohnt. Nichts hatte sie bisher getrennt. Sie hatte ein schlechtes Gewissen. Die Mutter tat alles für sie. Sie hatte nur sie, hatte sonst keinen Menschen. Und daß sie nie einen Vater für Beate gehabt hatte, trug sie jeden Tag mit ihrem Namen mit sich herum.
Beate war Fräulein Halvorsens uneheliches Kind, das wußten alle, was aus dem Vater geworden war, das wußte niemand. Auch Beate wußte es nicht. Sie hatte sich oft den Kopf darüber zerbrochen, hatte wissen wollen, was eigentlich los war. Wann immer sie das Thema anschnitt, winkte ihre Mutter ab. „Dazu gibt es nichts zu sagen“, erklärte sie. „Aber warst du mit ihm zusammen? Hast du ihn gekannt?“ fragte Beate. „Darüber reden wir nicht, habe ich gesagt. Wir müssen ihn vergessen, Mädi, das ist das Beste.“
Aber Beate konnte ihren Vater nicht vergessen, auch wenn er nur ein Schatten war. Er war ein Samenkorn gewesen, im Leib ihrer Mutter war er zu Beate geworden, und im letzten halben Jahr oder so hatte sie sich mehr den Kopf darüber zerbrochen als je zuvor. Sie träumte von ihm und hoffte, daß er zurückkommen würde. Er kam mit Geschenken aus Amerika. Ein andermal war er tot. Vielleicht war er im Duell gefallen. Oder er war ertrunken. Manchmal segelte er zwischen den Inseln des Stillen Ozeans, und auf den Inseln tanzte er mit Hula-Hula-Mädchen und trug einen Blumenkranz in den Haaren. Sie mußte einfach an ihren Vater denken; las sie „Die drei Musketiere“, war er einer von ihnen, las sie „Der Graf von Monte Christo“, war er das; er fand sich in allen Büchern Jack Londons, er umsegelte Kap Horn oder unterwarf sich König Alkohol, in den Flickabüchern ritt er über Wyomings Prärien, überall war er, denn Beate las ungeheuere Mengen von Büchern, und niemals hatte sie genug.
„Die Suppe ist fertig!“ rief ihre Mutter aus der Küche. Beate las schnell noch einen Abschnitt in „Segen der Erde“, ihrer derzeitigen Lektüre. Gerade hatte Inger Sellanraa ihr Kind umgebracht. Es hatte wie sie eine Hasenscharte. Beate weint innerlich, legt das Lesezeichen ins Buch und geht in die Küche. Sie füllt ihren Teller bis zum Rand mit Erbsensuppe. Erbsensuppe ist ihr Lieblingsessen. Es war klar, daß es das heute geben würde. Ihre Mutter sitzt an der anderen Seite des Küchentischs und bläst auf ihren Löffel. Auf dem leeren Hocker zwischen ihnen sitzt Beates Vater mit dichter schwarzer Mähne und lobt das Essen.
Die Mädchen aus Trara hatten immer etwas zu lachen. Vor allem eine Else, die am vorletzten Tisch an der Tür saß und sich mit Lippenstift bemalte. Dann kicherte sie zusammen mit den anderen Mädchen in ihrer Ecke. Sie hatte in ihrem Mäppchen einen Spiegel. Darin betrachtete sie ihren Lippenstift und ihren Mund, wenn der Lehrer das nicht sehen konnte, und danach prustete sie los. Manchmal warf sie sich vor Lachen über den Tisch, und wenn sie sich wieder eingekriegt hatte und sich umdrehte, um der mit der Zahnklammer am letzten Tisch etwas zuzuflüstern, war das, was sie sagen wollte, so komisch, daß sie es einfach nicht herausbrachte. Einmal lachte sie so sehr, daß sie vor die Tür gestellt werden mußte. Das war im Norwegischunterricht, sie nahmen gerade einen Roman von Gabriel Scott durch.
„Gabriel Scott, du meine Güte!“ sagten die Mädchen aus Trara, und dann gackerten sie los und wollten einfach nicht aufhören. Ob das denn wirklich so komisch sei, fragte Davidsen vom Pult herab. Aber das war es eben. Und deshalb mußte die mit dem Lippenstift vor die Tür gesetzt werden, sie war nämlich die Schlimmste. Sie kicherte den ganzen Weg vorbei an den Tischen und bis zur Tür, ihr Gesicht war rot vor Heiterkeit. Sie hieß Liv.
Inger mochte sie nicht, aber sie mußte doch immer wieder an sie denken. Auf dem Heimweg sagte sie zu Lillian: „Eine in meiner Klasse kann ich einfach nicht ausstehen.“ „Ach?“ fragte Lillian. „Ja, diese Liv Abrahamsen. Die ist so albern, daß die Hälfte wirklich reichen würde.“
Aber in jedem norwegischen Aufsatz bekam Liv ein Sehr gut. Wie war es möglich, sich mit Lippenstift zu bemalen und trotzdem Sehr gut im norwegischen Aufsatz zu bekommen?
Sie sollten beschreibende Aufsätze schreiben, erklärte Davidsen. Das war etwas anderes als in der Volksschule, sie waren schließlich älter. In der Volksschule hatten sie nur erzählende Aufsätze geschrieben, erklärte er. „Ein unvergeßlicher Ausflug“ und so. Jetzt sollten sie folgenden Aufsatz schreiben: „Eine Straße bei Regenwetter.“
Eine Straße bei Regenwetter, dachte Inger. Das war wie ein Bild. Sie dachte an Nygaardsgata, der Ecke Solheimhjørnet, wenn es regnete, und blickte zum Kirkepark hinüber.
„Es braucht keine bestimmte Straße zu sein“, sagte Davidsen. Und auch kein bestimmter Zeitpunkt. Es sollte zeitloser sein. Wie sieht eine Straße bei Regenwetter gewöhnlich aus?
Na gut, dachte die 1 B und schrieb das Thema in ihr Aufgabenheft. Zeitloser Regen. In vierzehn Tagen abzugeben.
In den beiden letzten Stunden am Montag hatten sie Zeichnen oben im Zeichensaal im Neubau, bei einem Mann namens Konsul Saxeby. Der war ein zackiger glatzköpfiger Herr mit spöttischem Blick und Goldzahn. Wovon er Konsul war, wußte niemand. Jedenfalls war er kein Studienrat, aber das war auch nicht nötig, schließlich sollte er der heranwachsenden Generation Form und Schatten beibringen.
Schon in der ersten Stunde schockierte er alle, als er einen Blumentopf vor ihnen aufpflanzte. „Den sollt ihr zeichnen!“
Einen Blumentopf zeichnen, meine Güte! Sowas von öde. In der Volksschule hatten sie Aufgaben gehabt wie „Der Nationalfeiertag“ oder „Die Zugvögel kommen zurück“ oder „Kinderspiele im Frühling“, wo sie das schwachsinnige Leben in Fredrikstad frei und in all seiner Farbenpracht zeichnen konnten. Aber einen Blumentopf!
Читать дальше