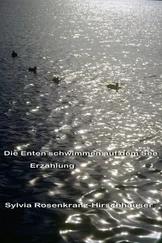An kalten Wintertagen bildeten sich an den Fenstern prächtige Eisblumen, oft in zwei bis drei Schichten überfroren. Wenn am Samstag der Ofen im Kinderzimmer angezündet wurde, schmolzen die dicken Eisblumen allmählich ab und bildeten auf der Scheibe in sich zerrinnende abstrakte Figuren und Formen. Die eben noch wunderschönen kristallenen Fransentulpen oder Dahlien mit weit gespreizten zackigen Blütenblättern nahmen bald eine traurige, armselige Gestalt an, um schließlich ganz zu verschwinden. Manche dieser dahinwelkenden Eisblumen erinnerten mich während des Zerlaufens an Nachtgespenster mit weißen langen Tüchern über dem Kopf, mit nur zwei großen schwarzen Augenlöchern und einem noch größeren schwarzen ovalen Loch als Mund.
So schön sich diese Figuren am Fensterglas ausmachten, des Nachts, in der Dunkelheit, kamen sie als furchterregende übergroße Geister wieder. Die Finsternis machte mir Angst. In solchen finsteren Momenten empfand ich das schreckliche Geplärre meines betrunkenen Stiefvaters groteskerweise plötzlich als wohltuend: Jemand war da und könnte mir in der Not helfen. Eine böse Ironie, denn in meinem Unterbewusstsein war eigentlich der Stiefvater selbst der wahre Not und Angst bringende Herold.
Meine Mutter schlief oftmals am Küchentisch sitzend und Strümpfe stopfend ein. Immer wieder fielen ihr die Augen zu, die Nadel rutschte aus der Hand, der Kopf nickte weg, das Kinn sank auf die Brust. Dann fuhr sie wieder hoch und stopfte weiter. Der Stiefvater wartete, bis ihr Kopf erneut nach unten fiel, und klatschte im gleichen Moment laut in die Hände, um sie zu erschrecken. Diese Bösartigkeit ließ er sich immer und immer wieder zuschulden kommen und verzerrte dabei sein Gesicht zu einer grinsenden Maske, wodurch die faltige, leicht nach innen gewölbte Stirn zwischen den dicken dunklen Augenbrauen und dem tiefen Haaransatz noch schmäler wurde. Er hatte sichtlich Freude an seinem Aufschrecken der gemarterten Mutter. Wenn sie nach der mühsamen, schweren Feldarbeit erschöpft und spät nach Hause zurückkehrte, ging ihre Arbeit im Stall weiter, wo sie das Vieh fütterte, während der Stiefvater schon in den Weinkeller verschwand, um zu trinken. Kam sie dann endlich ins Haus und setzte sich müde an den Küchentisch, um in der Zeitung, die jeden Mittwoch beim Greißler Smischek in Gettsdorf auslag und auf der in blauer Kursivschrift Die Wochenschau stand, den von ihr so geliebten Fortsetzungsroman „Ich werde auf dich warten“ zu lesen, konnte es sein, dass zwischenzeitlich der Stiefvater betrunken aus dem Weinkeller zurückkehrte. Dann waren seine einzigen Worte: „Hast du nix Besseres zu tun, es gibt noch genug Arbeit!“ Diese Ungerechtigkeit konnte ich nicht ertragen.
An einem Samstagabend, nachdem wir alle – erst meine Schwester und dann ich – in einem großen Holztrog gebadet hatten, der mitten in der Küche stand, saß Mutter wieder am Tisch und stopfte Socken. Nach dem dritten Versuch, sich wach zu halten, schlief sie abermals ein und diesmal fuhr sie nicht wieder hoch, sondern fiel kopfüber auf den Fußboden, den sie drei Stunden zuvor auf dem Boden kniend mit einer Bürste und Kernseife so lange gerieben und geschrubbt hatte, bis er endlich blitzblank und sauber war. Durch den Sturz waren Nase, Wangen und Mund aufgeschlagen und bluteten.
In den nächsten Tagen entzündeten sich ihre Verletzungen, und sie musste zum Doktor Meinrath nach Ziersdorf gehen, dem Gemeindearzt, der ihr eine Gesichtsmaske aus Leinen schneiderte, nur mit Augen und Mundlöchern – ähnlich wie die angstmachenden weißen Gespenster, die mir in der Finsternis manchmal erschienen oder die ich in die zerschmelzenden Eisblumen auf der Fensterscheibe des Kinderzimmers hineinsah. Unter die Stoffmaske schmierte der Doktor eine braune Heilsalbe, die Mutter täglich erneuern musste. Dennoch verschlechterte sich ihr Zustand immer weiter. Die Entzündungen wurden schlimmer und schmerzhafter. Dr. Meinrath teilte ihr mit, dass sie nicht nur entzündete Wunden habe, sondern auch noch Rotlauf bekommen hatte. Von dieser langwierigen und tückischen Krankheit würden eigentlich nur Schweine befallen. Ganz selten werde sie auch auf den Menschen übertragen.
Wie ich meine Mutter so mit der weißen Leinenmaske über dem Gesicht sah und an den Rändern der Leinenmaske die dicken Tränen bemerkte, die über ihre geröteten und verkrusteten Wangen kullerten, fühlte ich mich mit einem Mal so hilflos und unsicher, dass ich, um sie zu trösten und ihr großes, unerträgliches Leid zu lindern, in fröhlich lautes Lachen ausbrach, mit überdrehter Stimme irgendetwas von weißen Nachtgespenstern erzählte und ähnliche Faxen machte. Doch mein Versuch, eine bessere Laune zu verbreiten, missglückte, leise schluchzte meine Mutter weiter; ja, sie fing nun erst richtig zu weinen an, was jetzt auch mich todunglücklich machte.
Sechs lange Wochen lag meine gute Mutter im Bett. Der Stiefvater war völlig aus der Bahn geworfen, machte ihr täglich Vorwürfe und beschimpfte sie auf das allerschlimmste. Sie fühlte sich schuldig, beinahe den ganzen Tag war sie todtraurig und weinte. Ich litt mit ihr mit, betete zu unserem Herrgott, sie doch bald wieder gesund zu machen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme zu uns und dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, so auch auf Erden.
Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
Und führ uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von allem Übel.
Der Lokführer rieb die Hautfetzen mit einem Schneeball von der Lok
Der Warteraum des Ziersdorfer Bahnhofes war gut besucht. Die Fahrgäste warteten auf den Zug von Wien Franz-Josefs-Bahnhof nach Gmünd, wohin auch meine Mutter mit mir fahren wollte, um eine Tante zu besuchen. Es war immer noch Winter und kalt. Schneewehen wirbelten über die Schienen und der Wind ließ die blinkenden Schneekristalle an den Fenstern des Warteraums hochstäuben. Im Warteraum saßen nicht nur Reisende, die auf den Zug warteten, sondern auch Leute aus dem Ort, die etwaige Neuigkeiten in Erfahrung bringen wollten oder einfach nur einen gemütlichen, warmen Raum suchten.
Gemütlich war der Warteraum wirklich. Der gusseiserne Kanonenofen war mit wohlriechendem glühenden Koks gefüllt. Die braun lackierten, an den Kanten abgestoßenen Lamperien, die massiven dunklen Holzbänke, die um den großen, aus dem gleichen dunklen Holz gezimmerten Tisch geordnet waren, und der schwarz geölte Fußboden rochen einladend. An der linken Seite befand sich ein breites Fenster in den nächsten Raum, das im selben Braun lackiert war wie die Lamperie.
Im unteren Drittel des großen Fensters war eine kleine Schalteröffnung, und hinter dem Schalter saß der Bahnhofsvorstand und verkaufte die Fahrkarten. Seine rote Tellerkappe mit ihrem schwarz gelackten Schirm wurde rundherum von einer dünnen schwarzen Kordelschnur umfasst und vorn in der Mitte war ein Abzeichen, auf dem ÖBB stand. Auf der dunkelblauen Uniformjacke des Bahnhofsvorstands prangten goldene Knöpfe und verschiedene Abzeichen. Ich war fünf Jahre alt und fürchtete mich vor diesem Menschen. Solange ich zurückdenken kann, hatte ich vor Uniformen Respekt bis Angst. Wie war ich doch froh, als meine Mutter endlich die Fahrkarten dritter Klasse für uns in der Hand hatte. Was hätten wir bloß gemacht, wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich gewesen wäre, eine zu erwerben! Was wäre geschehen, wenn uns dieser Mann in seinen prangenden goldenen Knöpfen und Abzeichen die Fahrkarte einfach verweigert hätte!
Dieses Gefühl der überall lauernden unerwarteten Zwischenfälle verfolgt mich auch noch über sechzig Jahre später, bis zum heutigen Tag. Zwischenfälle, die plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen und alles zunichtemachen. Zwischenfälle, wie sie schon damals die Bahnfahrt von Ziersdorf nach Gmünd bereithielt.
Читать дальше