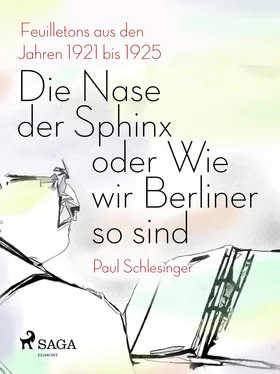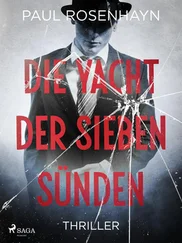»Wo kommt der Stock her?« tönt es durch den prasselnden Regen.
»Ich hab ihn mir gelangt.«
»Woher?«
»Vom Zaun ... er hing am Zaun.«
»Wie kommt er an den Zaun?«
»Weiß nicht. Ich habe immer darüber nachgedacht, wozu der Zaun da ist – jetzt weiß ich’s.«
»Und du hast ihn dir einfach genommen?«
»Natürlich – ich kann doch nicht noch eine halbe Stunde im Regen daneben stehenbleiben. Übrigens prima Malakka, zwanzig Goldmark.«
»Und du ... das geht doch gar nicht.«
»Du siehst doch, daß es geht. Hätte ich den Stock da hängenlassen sollen? In jeder Minute gehen fünfzig Leute vorüber, sehen ihn oder sehen ihn nicht – ich habe ihn gesehen.«
»Ob ihn jemand verloren hat?«
»Wahrscheinlich – übrigens ein ordentlicher Mensch, dieser Verlierer. Der schmeißt seine Sachen nicht einfach auf die Straße wie jeder andere Liederjahn, sondern hängt ihn an den Zaun.«
»Vielleicht war er betrunken, dacht’, er stünde im Regen wie zu Hause unter der Brause, und fing an, sich auszuziehen. Zuerst hängt er den Stock auf ...«
»Man zieht sich doch nicht unter der Brause aus.«
»Er war doch betrunken.«
»Hm.«
Endlich waren wir zu Hause. Wir trockneten den Stock ab, dann nahmen wir ihn mit ins Schlafzimmer wie einen zugelaufenen Hund.
»Vielleicht«, sagte ich, »ist der Stock weder verloren noch war der Verlierer betrunken – es war möglicherweise ein ganz normaler Mensch, der morgens mit einem Stock von Hause ausgegangen war, dann aber abends im Regen die völlige Unbrauchbarkeit eines Stockes einsah und ihn einfach von sich abtat.«
Schweigen. Eine Viertelstunde später, man hatte sich schon gute Nacht gesagt – meint die Frau etwas ängstlich: »Du ... gehst du mit dem Stock aus?«
»Natürlich, sowie die Sonne scheint.«
»Und wenn du nun dem Besitzer begegnest? Es ist ein so wundervoller, ein so charakteristischer Stock. Er erkennt ihn wieder, er kommt auf dich zu, er schlägt dich nieder ...«
»Womit? Er hat doch keinen Stock.«
»Richtig – den hast du ja«, und schläft beruhigt ein.
[1924]
Ei, da kommt Herr Knopel. Mit meinen guten Augen erkenn ich ihn auf hundert Schritt. Ach, und man hat so selten die Freude, ihn zu sehen. Früher war er mir direkt unsympathisch. Damals war er nämlich Besitzer unseres Hauses, und er hatte etwa zwanzig solcher Steinhaufen. Wahnsinnig höflich war er nie, er war überhaupt nicht wahnsinnig. Man galt bei ihm als Nummer, und es war ihm so unerhört gleichgültig, wer in einem seiner Steinhaufen wohnte. Deshalb schimpften wir auf ihn immer. Natürlich – begegneten wir uns auf der Straße, so zogen wir voreinander den Hut.
Bis ihm eines Tages die Sache zu dumm wurde und er in kühler Sachlichkeit seine sämtlichen Steinhaufen an eine Aktiengesellschaft verkaufte. Seitdem wir eine Aktiengesellschaft als Hauswirt haben, wissen wir Herrn Knopel zu schätzen. Bei ihm hatte jeder von uns wenigstens eine Nummer. Jetzt sind wir überhaupt nichts mehr, keiner von uns kennt die Aktiengesellschaft, mit der wir nur noch auf dem Prozeßweg verkehren.
Ist es da ein Wunder, wenn ich mich freue, dem guten Knopel zu begegnen? Schon nehme ich den Stock in die andere Hand und ziehe meinen Hut. Herr Knopel richtet seine klugen, kalten Fischaugen auf mich und richtet sie wieder weg. Er bewegt nicht die breiten, dicken Lippen, noch weniger fällt ihm ein, auch nur eine Hand aus der Überziehertasche zu nehmen, um nach dem Hut zu greifen. Er grüßt einfach nicht wieder.
Da krieg ich eine Wut und stelle ihn: »Herr Knopel, ich habe Sie gegrüßt.«
»Na ja, und?«
»Herr Knopel, wir sind persönlich bekannt!«
»Wir waren bekannt miteinander. Sie wohnten in einem meiner Häuser. Ich habe die Häuser verkauft. Da sind wir doch nicht mehr persönlich bekannt miteinander. Das Grüßen kann doch nicht in alle Ewigkeit einfach so weitergehen – sparen wir uns die Mühe.«
Wendet sich um, läßt mich stehen.
Ich aber seh ihm nach, bewundernd. Wahrlich, ein großer Mann, dieser kleine Herr Knopel. Wieviel Mühe könnte man sich sparen, wenn man konsequent nach seinem Rezept verführe. Ich habe zwar nie ein Haus mit numerierten Menschen besessen. Aber habe ich nicht auch drei- bis fünfhundert Bekannte, die ich nicht mehr kenne und vor denen ich aus purer Dummheit den Hut ziehe.
Schon kommt einer mit ausgebreiteten Flossen auf mich zu: »Sind Sie nicht der Herr Vetter von Herrn Pichel?«
»Nein.«
»Aber Sie wohnten doch früher in der Steinstraße.«
»Nein.«
»Aber Ihre Frau spielt doch Klavier?«
»Nein.«
»Aber Sie waren vorigen Sommer in Warnemünde?«
»Nein.«
»Aber Sie haben vor zwanzig Jahren in Heidelberg studiert?«
»Nein.«
»Aber Himmeldonnerwetter, wir kennen uns doch?«
»Natürlich kennen wir uns«, sage ich kühl. »Wenn Sie es durchaus wissen wollen: Sie haben vor genau dreißig Jahren meine Kusine Frieda von der Tanzstunde nach Hause gebracht und ihr bei der Gelegenheit zwei Küsse gegeben, wofür Sie am nächsten Tag von mir zwei Ohrfeigen bekamen.«
»Ach ja, richtig«, sagt er tief geknickt. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, zieht (noch mal) den Hut, läßt eine von grauen Haaren umstandene Glatze sehen und verschwindet.
Und nun frage ich: War das unbedingt nötig?
Hat nicht Knopel ganz recht?
[1924]
Der Laden und die Brautkutsche
Was ich nie herausbekomme: warum es nun grad so viel Läden gibt, als es gibt. Warum gerade da ein Friseur und dort ein Hutgeschäft.
Und gar in unserm Sträßchen, das so gar keine Ansprüche darauf macht, ein kommerzielles Zentrum zu sein.
Also neben uns hatte ein Friseur seinen Laden. Drin war ich nie, aber ich wünschte dem blonden, bleichen Herrn, der in den Nachmittagsstunden vor der Tür stand und auf Kundschaft wartete, stets alles Gute. So weit konnte ich sehen: Es war ein bescheidener, aber sauberer Laden. Vielleicht hätte ich doch einmal hineingehen sollen.
Eines Tages war er weg. Der Friseur und sein ganzer Laden – das heißt: alles, was so drin stand: die Patentstühle, Spiegel und im Fenster die unwahrscheinlich frisierten Wachsdamen.
Am nächsten Morgen aber begann ein neues Leben. Es kamen Schreiner, Schlosser, Maler. Und als alles fertig war, stand drauf: »Echte Teppiche, Luxusmöbel«. Dazu eine überaus klangvolle Doppelfirma. Das Schaufenster wurde noch dekoriert. Da lag also wirklich ein irgendwie echter Teppich. Auch standen einige Möbel drauf, die ich nie geschenkt genommen hätte, also die Bezeichnung Luxus durchaus verdienten. Ein dunkler Herr, der im Schaufenster hantierte, stellte noch gerade eine bemalte Wasserpfeife auf den Teppich. Das Eleganteste aber war ein eiserner Vorhang, eine Gardine aus Eisenmaschen, die des Abends zugezogen wurde und die deutlich besagte: Besuch von Einbrechern höflichst verbeten.
Dann beruhigte sich der Laden und ich mich auch. Ich nehme an, daß der dunkle Herr, der keine Kosten gescheut hatte, die Zeit damit zubrachte, auf Kundschaft zu warten.
Ein halbes Jahr hat sich an der Schaufensterdekoration nicht das mindeste geändert. Die Wasserpfeife stand auf dem sozusagen echten Teppich.
Und heute ist der Laden leer. Plötzlich. Am Fenster aber steht ein Anstreicher und malt mit zierlicher Schrift: »Modes«. Durch die große Scheibe sehe ich zwei große weiße Schränke und ein junges Mädchen, das hoffnungsvoll Vorhänge näht.
Oh, ich wünsche Ihnen so viel Gutes, mein Fräulein, denke ich, für die Monate, die Sie an diesem Fenster auf Kundschaft warten werden. Ich habe so viel Bewunderung für den Mut eines Menschen, der sich etabliert, und gerade in unserm Sträßchen.
Gerade kommt eine Kutsche vorbei, mit jungen Apfelschimmeln bespannt. Eine äußerst elegante Brautkutsche. Darin sitzt – noch einsam – ein junger schöner Herr im Frack. Ganz glatt rasiert, hoffnungsfreudig. Ich denke mir, der hat Mut und sich in der Kutsche etabliert. Ob Kundschaft kommt?
Читать дальше