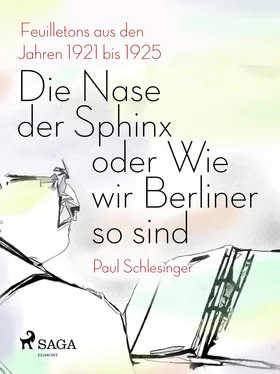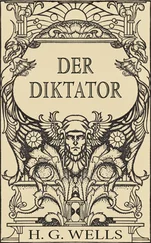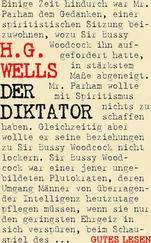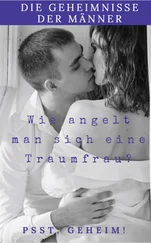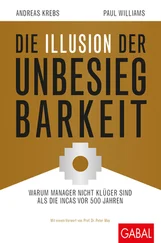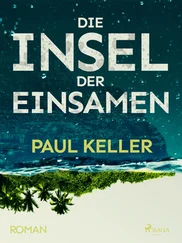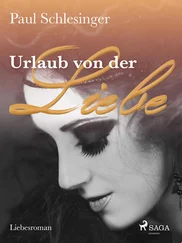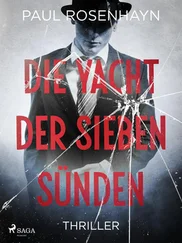Wie nett und anständig besiegen die blonde Steffi, die dunkle Pepi ihre Partnerinnen! Man watscht sich die braunen Boxhandschuhe um die sorgfältig geschminkten Wangen – der tapfere, messende, aufmerksame Blick aus Franzis schönen Augen ist sogar eine kleine Sehenswürdigkeit, und keinem Mann wäre es unangenehm, so betrachtet zu werden. Wird die Runde abgepfiffen, so ist die Helferin nicht nur um Kühlung für die Ruhende besorgt, sie bringt auch die Löckchen unter der weißen Kampfhaube in Ordnung. Jawohl, dem Spiel eurer Kräfte sah ich gerne zu. Denn Zierlichkeit blieb eurem Kampf nicht fremd, und Mut und Geschicklichkeit, auch des Sportes Ehrsamkeit widersprachen nicht eurem Weibsein!
Dann aber kam Ilona. Mit dunkler Wut betrachtete sie schon vom Stuhle aus ihre Gegnerin, die blonde Fritzi aus Bayern – ein Pfiff: Ilona springt auf wie ein wildes entfesseltes Raubtier. Die eigene Wut scheint ihr nicht groß genug, sie stößt wütende Zischlaute aus, gellende Kriegsrufe. Ob dieser Unsportlichkeit ist das Publikum halb empört – halb belustigt. Nur die Belustigung wächst zum Taumel. Denn Ilona hüpft dröhnend, wie auf vier Füßen, um die Gegnerin, sie schreit, sie rast, sie tobt. Mit den Händen teilt sie verbotene Püffe aus – aber sie begnügt sich nicht mit den Händen. Als ihr unversehens die Partnerin auf die Zehen tritt, heult Ilona wild auf, erst in Schmerz; dann in Wut. Sie versucht den Fußtritt zu erwidern. Trotz der warnenden Pfeife boxt sie weiter oder hört auf zu boxen, umschlingt den Hals der Gegnerin. Der Schiedsrichter will sie trennen, da stürzt sie sich auf ihn, um ihn regelrecht zu verprügeln. Er besinnt sich auf seine Würde und gibt ihr eine schallende Ohrfeige. –
Pause. – Ilona ruht mit zitternden mächtigen Flanken, Arme, Beine weit von sich gestreckt. Das Auge in wirrer Versunkenheit, Haß, Rache speiend. Noch einmal geht es zum Kampf – Ilona besinnt sich auf keinen Schlag mehr, der erlaubt ist. Sie stößt mit den Füßen, sie heult, sie zischt; das Publikum schreit: »Raus, raus!« Da schlägt Fritzi mit einem Schlage Ilona nieder, so daß sie unter den mit Flaschen besetzten Tisch der Unparteiischen fällt – besiegt. Aber Ilona springt wieder auf, trägt den Tisch plötzlich auf dem Rücken – die Flaschen fallen vom Tisch, die Unparteiischen von den Stühlen, der Tisch vom Rücken Ilonas, die sich mit neuer Wut auf Fritzi stürzen will. Indessen man bändigt sie – die wilden Proteste des Publikums erwidert sie mit wilderen unartikulierten Lauten. Einen Augenblick fürchtet man, sie könne ins Publikum hinabspringen, nicht weniger furchtbar als ein entlaufener Löwe.
Oh, Kowatsch Ilona – lehn deine Wang’ niemals an meine Wang’!
Juni 1921
Seitdem es Musikabteilungen in Warenhäusern gibt, sitzt in einem Winkel eine Dame am Klavier und spielt auf Verlangen den neuesten Tanz. Diese Dame gehört zu den Erscheinungen, an die man sich nicht gewöhnen, mit denen man sich durchaus nicht abfinden kann. Irgendwie stolpert das Gefühl des Gleichgültigsten, der vorbeischreitet. Man sieht es an den Mienen derer, die da gehen, betrachten, befühlen, befragen, bedenken. Sie heben plötzlich, irgendwie aufgestört, den Kopf. Sie können, und sei es für Sekunden, nicht weitersprechen. Man erinnere sich an eine häusliche Szene: Die Tochter übt am Klavier; man erträgt es. Plötzlich wird eine Rechnung präsentiert. Man ruft: Frida, höre einen Augenblick auf.
Die Gefangennahme der Sinne durch Musik schließt zuweilen jede Tätigkeit aus, die den wägenden oder logischen Verstand erfordert. Die Gegenprobe: im Kino. Der entsetzliche Geiger und die verdammenswerte Klavierspielerin machen eine an sich höchst löbliche Pause. Inzwischen rollt oben ein Film weiter. Es geht nicht – das Herz des Musikalischsten schreit nach irgendwelchen noch so falschen Tönen. Denn Verstand und Logik sind beim Film so weit ausgeschaltet, daß nur durch gleichzeitiges Erklingen von Tönen das seelische Gleichgewicht hergestellt werden kann. Folgt man im Warenhaus den Tönen, tritt man der Klavierspielerin etwas näher, so erweitert sich das Problem. Es geschieht nämlich an jenem Klavier etwas, das nicht nur durch Klang und Rhythmus das Gefüge des Warenhauses erschüttert.
Man blicke (im Gegensatz) vom zweiten Stock hinab in dieses gewaltige, glitzernde Luftschloß von Glas, Marmor, sich spannenden Bögen, sich überschneidenden Treppen. Alles, was hier geschieht, vollzieht sich chorisch. Wünsche, Begierden, Vermögen, Geschmack, Ansprüche der Kaufenden – Geschick, Kenntnis und Arbeitsamkeit der Verkäufer mögen noch so verschieden sein – es ist ein Aufundab, ein Handhaben und Sichgeben im selben Rhythmus. Wohl läßt sich eine Dame einen Stoff um die Schulter legen. Es stört nicht, denn jeder ist in sich selbst versunken. Mit derselben sinnlichen Empfindsamkeit prüft man im Warenhaus Bücher. Anders als im Buchladen. (Man wittere keine boshafte Absicht – nichts soll gegen den Kauf von Büchern gesagt sein. Wo auch immer. Nur kaufen!) Aber jeder prüft tastend für sich. In dem ungeheuren gleichmäßigen Treiben – jedes ein traumwandelnd Unbekanntes für sich. Frauen laufen hier an ihren Männern und Kindern vorbei, ohne sie zu erkennen.
Da tönt das Spiel. Es ist, als verlange man Handschuhe, und die Verkäuferin sagt: Nehmen Sie doch Marmelade. Als frage man: Wo ist das Seifenlager? und bekommt die Antwort: Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Die junge Dame am Klavier hat von den tausendfachen Seelenstörungen, die sie bereitet, keine Ahnung. Sie hat allerdings überhaupt nicht viel davon. In ihrem mürrischen Blond sitzt sie da und bringt Töne hervor, verkäufliche Töne. Sie hat gar keinen musikalischen Ehrgeiz; sie ist überhaupt völlig ohne Pose, und wenn ihre Hände zu den Tasten niedergehen, fliegen sie gleichgültig wie fortgeworfenes Papier. Sie hat sich auf ein Inserat gemeldet: »Junge Dame, die vom Blatt spielen kann, gesucht ...« Nun hat sie den Posten, alles übrige kümmert sie nicht. Ob die Töne falsch oder richtig sind, untersteht nicht ihrer Verantwortung. Sie ist engagiert. Und wem’s nicht paßt, der sage es ... Aber drei junge Mädchen kommen vorbei, legen den Kopf zur Seite, träumerisch. Sie fragen, wie der neue Trott heißt. Dann nach dem Preise, und dann kaufen sie – und der, der seine Sondergefühle spazierenführt, hat, wie gewöhnlich, unrecht.
Februar 1921
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.