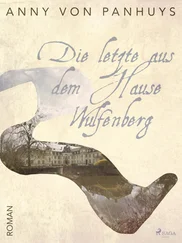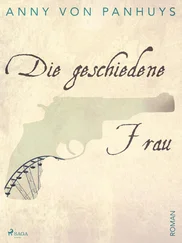„In Ihrem Alter kriecht man nicht mehr so ganz aus seiner Haut heraus, dazu ist sie schon zu fest gewachsen. Nein, nein, zu Experimenten habe ich kein Vertrauen. Um Wiesenthal steht es sehr schlecht, und Sie rechnen damit, daß Bettina eine reiche Erbin ist und ihre Mitgift nicht zu knapp ausfallen dürfte.“
Wulf von Speerau erhob sich.
„Sie beleidigen mich, Herr von Zweilinden.“
„Ich stelle nur Dinge fest, die naheliegen“, war die ruhige Antwort. „Bettina werde ich den Grund mitteilen, der mich veranlaßt hat, Ihnen meine Zustimmung zur Ehe mit ihr zu verweigern. Sie ist vernünftig und wird sich freiwillig fügen.“
Der Graf nahm sich mit aller Kraft zusammen; aber die Wut, daß dieser Besuch so geendet, erstickte ihn fast. Er konnte kein Wort mehr sprechen, verneigte sich nur stumm und verließ hastig das Zimmer.
Ins Freie wollte er, allein sein, um nachzudenken, wie er den Entschluß des Pflegevaters Bettinas ändern konnte. Er mußte ein Mittel dazu finden.
Er brachte es noch fertig, dem Diener, der ihm Hut und Mantel aushändigte und den er seit Jahren kannte, ein paar freundliche Worte zu sagen.
Nachdem sich Wulf Speerau ein Stückchen vom Herrenhause entfernt hatte, tat er sich keinen Zwang mehr an. Er schimpfte halblaut vor sich hin, er konnte einfach nicht anders.
„Verdammter Moralfatzke, blöder Sittenrichter, alter Spießer!“ betitelte er den Pflegevater Bettinas, dem die Tochter zu schade war für ihn. Durch seinen Kopf tanzten die Gedanken einen wilden Reigen und verwirrten ihn. Er sann verzweifelt: Wie fing er es nur an, den Unnachgiebigen umzustimmen?
Er wanderte erst ein Stück auf dem Waldwege dicht an der Chaussee entlang, dann ging er wardein und lief in die Kreuz und Quere. Seine Füße gebärdeten sich so wie sein Kopf – beide hielten keine bestimmte Richtung inne. In Wulf Speerau hallten noch die Sätze nach, die ihn am meisten geärgert, weil er sich durchschaut sah. Konrad Zweilinden hatte ihm auf den Kopf zugesagt: „Um Wiesenthal steht es schlecht, und Sie rechnen damit, daß Bettina eine reiche Erbin ist und ihre Mitgift nicht zu knapp ausfallen dürfte!“
So durchschaut zu werden, war natürlich das Fatalste, was ihm hatte passieren können.
Er dachte, so unangenehm der Satz gewesen, lag doch in ihm das Zugeständnis, daß Bettina eine reiche Erbin war. Man nahm ja auch allgemein an, Bettina war Konrad Zweilindens Universalerbin; aber schließlich wäre immerhin möglich gewesen, ihr Pflegevater würde ihr nur einen Teil seines Reichtums geben.
Sein Sohn Ottfried war verschollen, wahrscheinlich sogar tot, indes selbst wenn er lebte, zählte er für den Vater nicht mehr mit. Über sein Pflichtteil hinaus bekäme er sicher nichts, falls der Herr von Zweilinden stürbe und sein Sohn noch einmal auftauchen würde.
Ein häßlicher Gedanke drängte sich vor. Wenn Konrad Zweilinden stürbe, ehe er mit Bettina über ihn redete und ihr mitteilte, warum er ihn abgewiesen, dann wäre alles gut. Er seufzte laut. Aber erstens würde der alte Herr wahrscheinlich sofort mit Bettina sprechen, und zweitens, auch mit der größten Kraft seines Wunsches und Willens allein konnte er ihn nicht töten.
Bei einer Gehbewegung spürte er den Revolver in seiner Tasche. Mechanisch holte er ihn hervor und dachte, wer ihn wohl fortgeworfen oder verloren haben mochte. Eine hübsche, gediegene Waffe war es. Er steckte sie wieder ein.
Plötzlich hörte er dumpfes Räderrollen. Er hatte ein vorzügliches Gehör und stellte sofort fest, obwohl er sich ziemlich weit von der Chaussee entfernt hatte, das Räderrollen kam aus der Richtung von Zweilinden.
Ein unklarer Gedanke zwang ihn, in rasender Hast quer durch den Wald zu laufen, um die Chaussee wieder zu erreichen und dorthin zu gelangen, wo sie sich mit der Chaussee nach der Kreisstadt kreuzte. Es war anzunehmen, der Wagen, dessen Räder er hörte, war der Konrad Zweilindens, der jetzt als Sachverständiger zum Termin in die Stadt fuhr.
Daß er dorthin mußte, hatte er ja vorhin erklärt.
Wulf Speerau wollte noch einmal sein Heil versuchen. Der Gutsherr von Zweilinden fuhr meist ohne Kutscher. Möglicherweise konnte man hier draußen noch ein vernünftiges Wort mit ihm reden.
Während er die Stelle, wo sich die Chaussee kreuzte, im Schnellaufe zu gewinnen suchte, schoß ihm durch den Kopf, daß Konrad Zweilinden wahrscheinlich noch gar nicht mit Bettina über ihn geredet hatte, sonst würde er wohl nicht so schnell von zu Hause fortgekommen sein, und das bedeutete schon einen Vorteil.
Der Graf erreichte sein Ziel, und richtig, da kam der kleine Jagdwagen, den Zweilinden meist für seine Fahrten benutzte, von rechts mit mäßiger Geschwindigkeit heran.
Kein Mensch war zu sehen weit und breit. Außer ihm selbst und Zweilinden befand niemand sich in der Nähe. Die Chaussee war selten belebt um diese Zeit. Die Milchwagen fuhren ganz früh, und zu Waldspaziergängen hatten die Bauern der Umgebung keine Zeit. Sie befanden sich jetzt in der Wirtschaft und auf den Feldern, die bei Zweilinden begannen, wo der Wald seitlich zog, oder da drüben hinter ihm auf der anderen Seite. –
Ein schneller Rundblick überzeugte Wulf Speerau, es gab keinen Menschen in seiner Nähe, und wenn er geschickt war, dann wäre es gar nicht so schwer. –
Er tastete nach dem Revolver, trat hinter einen starkstämmigen Baum.
Der Wagen des Gutsherrn von Zweilinden näherte sich, nahm langsam die Kurve, um in die Chaussee nach der Kreisstadt einzubiegen. Im gleichen Augenblick krachte ein Schuß. Das Pferd bäumte sich und raste wie toll davon, in der Richtung auf die Kreisstadt zu. Wulf Speerau aber sah noch, wie der Körper Konrad Zweilindens langsam hintenüberfiel und halb über dem Fahrsitz hing.
Er ließ den Revolver fallen. Mochte man ihn hier finden. Er aber stürmte, wie von Furien verfolgt, waldein, und erst nachdem er ein großes Stück zwischen sich und den Ort seiner Tat gelegt hatte, ging er wieder langsamer. Nun hieß es, zunächst sich zu beruhigen. Das war die Hauptsache.
Der Graf holte einen Taschenspiegel hervor und betrachtete sich. Sein Hut saß ein wenig schief, aber sein Gesicht sah aus wie immer, fand er. Den Hut rückte er gerade, und dann zwang er ein Lächeln um seine Lippen, begann überlaut zu pfeifen – eine Marschmelodie. Er wollte nicht hören, wie ein Wagen auf der Chaussee nach der Kreisstadt dahinjagte.
Viele Fragen bedrängten ihn. War Konrad Zweilinden tot, oder hatte er schlecht getroffen, hatte er ihn nur verwundet? Und wenn er ihn nur verwundete, war er von ihm gesehen worden? Ihm war flau zumute, aber er pfiff weiter. Falls ihm jemand begegnete, sollte er den Eindruck gewinnen, er befände sich in guter Stimmung.
Er erreichte Schloß Wiesenthal, ging pfeifend in sein Zimmer, machte allerlei Arbeiten, die höchst unwichtig waren. Aber die Unruhe trieb ihn dazu. Mit irgend etwas mußte er die Zeit ausfüllen, denn bald würde er ja hören, ob ihm geglückt war, den Störenfried auszuschalten, der seine Pläne über den Haufen geworfen. Vor allem: für immer.
Er aß zu Mittag wie sonst, machte der alten Köchin, die schon bei seinen Eltern in Diensten gestanden und die selbst die Speisen auftrug, Komplimente, wie gut sie koche, und tat äußerst vergnügt.
Gegen zwei Uhr, als er, eine Zigarre rauchend, am offenen Fenster seines Arbeitszimmers saß, kam Ludwig West, sein Inspektor, zu ihm. Er war sichtlich aufgeregt und strich vor Aufregung seinen langen grauen Vollbart.
„Herr Graf, denken Sie doch nur, es heißt, Herr von Zweilinden wäre erschossen worden. Sein Pferd soll mit dem Jagdwagen in toller Fahrt in die Kreisstadt gerast gekommen sein und vor dem Hotel ‚Eichkatz‘, wo Zweilinden immer haltzumachen pflegt und manchmal ausspannt, stillgestanden haben. Im Wagen aber, ganz zusammengefallen, hätte Zweilinden gelegen. Tot! Von einer Kugel mitten ins Herz getroffen! Du lieber, guter Gott, ist das nicht furchtbar? Die Polizei ist schon auf den Beinen, heißt es, und die Mordkommission aus Frankfurt wird erwartet.“
Читать дальше