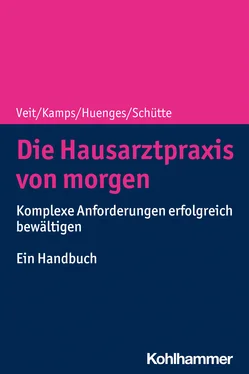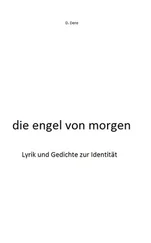Der immer sehr selbstbewusst und charmant auftretende 50-jährige Mann arbeitet auf der mittleren Führungsebene eines Software-Unternehmens, ist verheiratet und hat zwei adoleszente Kinder. Er hat im frühen Erwachsenenalter einen Herzinfarkt erlitten, der in der ihn auch jetzt behandelnden Praxis erkannt und als Notfall erfolgreich stabilisiert wurde. Er stellt sich auch trotz der Erkrankung als erfolgreich und unabkömmlich im Beruf und als fürsorglicher und verantwortlicher Familienvater und Ehemann dar, der alles im Griff hat. In sein Bild von Perfektion gehört auch der Mythos der perfekten Familie.
Seine gleichzeitig in der Praxis behandelte Ehefrau, nicht berufstätig, tritt eher zurückhaltend und unsicher auf; ihre Beratungsanlässe erschienen der Ärztin eher als Bagatellen. Dies ändert sich erst, als die Patientin wegen eines Panikanfalls und nachfolgender stationärer Behandlung wieder in der Sprechstunde erschien. Jetzt gewann die Patientin für die behandelnde Ärztin, die immer stolz auf die »Rettung« des Ehemanns war, mehr Bedeutung, und erhielt mehr zeitliche Zuwendung seitens der Ärztin. Die Verschiebung von Aufmerksamkeit und Bedeutung schien den Ehemann erheblich zu kränken und ihn neidisch und eifersüchtig zu machen. Er schien zu befürchten, dass in den Gesprächen mit der Ehefrau Dinge zu Tage treten könnten, die am Mythos der perfekten Familie kratzen und ihn in den Augen der Ärztin beschämen könnten. Die Ärztin führte das auf seine Angst zurück, dass seine Ehefrau größere Selbstständigkeit gewinnen könnte, die das bisherige Konstrukt des Zusammenlebens in Frage stellen würde. Zu einer Aussprache darüber kam es nicht. Die Beziehung zur Ärztin wurde seinerseits kühler und noch konfliktreicher. In trotziger Haltung lehnte er sogar notwendige kardiale Kontrolluntersuchungen ab. Dies mag auf seine narzisstische Krankheitsverarbeitung zurückzuführen sein, aber kann auch als Reaktion auf die verschobenen Gewichte der Zuwendung und als Scham-Wut und trotziger Protest gegen die Bevorzugung der Ehefrau verstanden werden. Er gefährdete sich damit selbst in erheblichem Ausmaß.
Wie das Beispiel zeigt, kann verschobene Zuwendung bisherige Gleichgewichte in der Familie beeinflussen; verschiedene Mitglieder können um die ärztliche Aufmerksamkeit ringen, und ärztliche Interventionen gegenüber dem Einen haben Folgen für die Beziehungsgestaltung zum anderen. Auch Gender-Aspekte spielen eine Rolle. In eine Hausärztin kann sich der männliche Patient verlieben und umgekehrt; Eifersucht kann in der Ehefrau entstehen und zur Beeinträchtigung ihrer Beziehung zur Behandlerin führen.
Auch Hausbesuche können Schamkonflikte hervorrufen, weil sie einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Nicht immer ist ein solcher Blick erwünscht. Naheliegende Konsequenz wäre, Hausbesuche anzukündigen und die Einwilligung der Betroffenen immer einzuholen.
Schamkonflikte bei Hausbesuchen
Ein Angehöriger eines alten Ehepaares forderte einen Hausbesuch ein, weil er sich Sorgen um den dementiellen, deutlich älteren Ehemann machte. Der Hausärztin schien die Ehefrau den 1950er Jahren entsprungen zu sein, immer sehr gepflegt mit hochtoupierter, schwarz gefärbter Frisur. Sie willigte in den Hausbesuch ein, ohne sich der Zustimmung der Ehefrau versichert zu haben. Sie fand die Ehefrau in einem für sie ungewöhnlichen Zustand des bisherigen Arrangements mit aufgelöstem Haar und unaufgeräumtem Haus vor. Die Ehefrau wandte sich brüsk gegen diesen Besuch. Die Hausärztin nahm sich vor, nie wieder, außer im Notfall, ohne Rückversicherung bei den Betroffenen einen Hausbesuch durchzuführen.
Die Sorge der Hausärztin blieb, dass Schamgefühle der Ehefrau die Betreuung des Ehemanns beeinträchtigen könnten.
Eine ca. 35 Jahre alte Patientin stellt sich erstmals mit einer Vielzahl körperlicher Beschwerden vor. Auffällig ist, dass sie schon in den ersten Sätzen vorbringt, dass ihre Symptome stressbedingt seien. Im Verlauf des Erstgesprächs schildert sie eine häusliche Szene, die dem Besuch in der Praxis vorausgegangen ist. Der Ehemann habe sie aufgefordert, zum Arzt zu gehen, weil ihre Beschwerden doch eine körperliche Ursache haben müssen. Sie dagegen hatte erneut und zum wiederholten Mal den Vorwurf erhoben, er sei schuld an ihrer misslichen Lage.
Beide Partner streiten mit gegenseitigen Schuldvorwürfen verbittert um den Einfluss auf das einzige Kind und um dessen Zuneigung. Der Streit eskaliert, als innerhalb der Herkunftsfamilie des Mannes ein Gewaltverbrechen geschieht. Sein Vater ermordet anscheinend in einem Impulsdurchbruch die Mutter. Nun hält die Patientin ihrem Mann seine »böse« Herkunftsfamilie vor und will den Einfluss der eigenen Herkunftsfamilie auf das gemeinsame Kind stärken. Er fühlt sich einsam und isoliert und ist neidisch auf die »gute« Familie seiner Frau. Beide Familien wohnen im selben Ort. Mit dem Praxisbesuch hegt die Patientin die Hoffnung, die Diagnose einer durch Stress und Erschöpfung bedingten Krankheit ihrem Mann an den Kopf werfen zu können. Ihre Erwartung an die Hausärztin ist, sie möge mit ihrer Diagnose einer psychischen Störung Munition für ihren Kampf mit dem Ehemann liefern. Zwar wird eine somatische Ursache der Beschwerden der Ehefrau aufgedeckt, das Schuldthema wirkt jedoch weiter. Später findet der Ehemann die »Lösung«, unter Vorgabe beruflicher Zwänge mit seiner Kleinfamilie aus dem Einflussbereich der »guten« Familie fortzuziehen.
Ärzte sollten sich die Frage stellen, was sich im Vorfeld des Praxisbesuches in der Familie abgespielt haben mag. Familienmitglieder versuchen, die Ärztin – in diesem Fall durch ihre Diagnose – für sich zu instrumentalisieren, denn ihr autoritatives Gewicht kann die Gesamtbalance im hierarchischen Gefüge einer Familie verschieben. Sie kann durch ihre Expertenautorität Munition im gegenseitigen Kampf liefern oder auch entlasten.
Die Patient-Familie-Arzt-Beziehungskonstellation erweitert die Erwartungen, die an den Arzt gestellt werden. Er muss versuchen, ein System zu verstehen, in dem Schuld- und Schamkonflikte bedeutsam sind und um die einflussreichste Position im Familiengefüge gekämpft wird. Ob er will oder nicht, er soll zum Mitspieler einer Familieninszenierung werden. Diese Rolle muss er nicht übernehmen.
3.4 Die Familie als Ort der Fürsorge
Es mag der Eindruck entstehen, dass hier die Familie unter negativen Vorzeichen gesehen wird. Doch an erster Stelle ist die Familie ein Ort der Fürsorge und eine große Ressource für alle Kranken und Sterbenden und ebenso für die Erhaltung von Gesundheit ihrer Mitglieder. Krank ist man nie allein. An eine Erkrankung muss sich die gesamte Familie anpassen, und eine chronische Erkrankung des einen hat Folgen für die anderen. Unter den Folgen eines Prostatakarzinoms leidet auch die Lebensqualität der Ehefrau. Geschwisterkinder fühlen sich durch die Krankheit eines Geschwisters nicht selten zurückgesetzt. Paarkonflikte bei Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind im Vergleich mit anderen Paaren gravierender, um nur einige Beispiele zu nennen. Fast alle Erkrankungen bringen das bisherige Gefüge einer Familie durcheinander. Bei Erkrankung der Ehefrau muss vielleicht der Ehemann und Vater Aufgaben übernehmen, die er bisher nie hatte, und die gesamte Familie muss eine neue Balance finden, die ihre Funktion weiterhin gewährleistet. Wenn dies gelingt, wird auch der Verlauf der Krankheit positiv beeinflusst, wie eine Studie über den Verlauf einer KHK bei Frauen belegt. Eine positive Paarbeziehung verbessert die Rückbildung der KHK (Orth-Gomez 2009). Überhaupt belegt die Forschung zur Krankheitsbewältigung die Bedeutung guter sozialer Beziehungen – Beziehungen sind heilsam – und die Familie ist auch heute noch das wichtigste Beziehungsgefüge.
Читать дальше