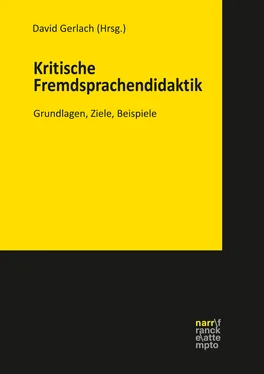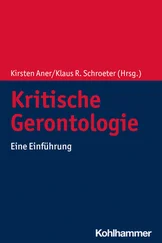Kritische Fremdsprachendidaktik
Здесь есть возможность читать онлайн «Kritische Fremdsprachendidaktik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kritische Fremdsprachendidaktik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kritische Fremdsprachendidaktik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kritische Fremdsprachendidaktik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kritische Fremdsprachendidaktik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kritische Fremdsprachendidaktik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Anschließend an die stärker grundlagentheoretisch orientierten Beiträge von Plikat sowie Bonnet und Hericks, mithilfe derer auch immer mögliche Folgen für die Rolle von Fremdsprachenlehrkräften potenziell mitgedacht werden können, beschäftigen sich die letzten Beiträge stärker mit den Lehrpersonen in einem kritischen Fremdsprachenunterricht. Michael Schart betont zum Beispiel die durchaus nicht ungefährliche Rolle von kritischen Deutsch-als-Fremdsprache-(DaF-)Lehrpersonen, die in diversen Kontexten arbeiten, in denen Freiheit oder Demokratie möglicherweise eingeschränkt sind. Am Beispiel eines universitären Deutschunterrichts in Japan stellt er fünf Prinzipien heraus, wie kritisches Denken zumindest angebahnt und in dialogischen Unterrichtsprozessen produktiv genutzt werden kann. Gleichzeitig betont er die Bedeutung einer Lernkultur, die immer wieder von den beteiligten Personen (also Lehrenden wie Lernenden) neu geschaffen werden muss.
Dagmar Abendroth-Timmer zeigt, wie Fremdsprachenlehrer*innenbildung sowohl individuelle Reflexion seitens der Lehramtsstudierenden anstoßen als auch ein kritisches Bewusstsein fördern kann. Auf der Basis von fallbasierten Konfliktsituationen aus Praxisphasen werden Französisch- und Spanischstudierende in einem dramapädagogischen Setting zur kritischen (Selbst-)Reflexion und gemeinsamen Peer-Reflexion angeleitet, um besonders Kognition, Emotion und Leiblichkeit im Zusammenhang mit dem Konflikt verbalisieren zu lernen.
Gemeinsam mit Kenneth Fasching-Varner stelle ich abschließend Grundüberlegungen dahingehend an, wie eine kritische Fremdsprachenlehrer*innenbildung ausgestaltet werden könnte, welchen Prinzipien sie folgen müsste und wie sie sich – ohne größere Umstürze – in die Strukturen des deutschen Lehrer*innenbildungssystems einbinden lassen könnte. Die vielen Konjunktive sind hierbei gewollt: Entstanden ist ein Papier, das Ideen skizziert und auf internationale theoretische wie empirische Forschung rekurriert, welche erste Versuche unternommen hat, kritische Perspektiven in die Fremdsprachenlehrer*innenbildung einzubringen. Inwiefern diese Maßnahmen im deutschsprachigen Raum auf fruchtbaren Boden treffen, wird die Zukunft zeigen.
Covid-19 und kritisches (Nicht-)Wissen
Die Mehrzahl der Beiträge ist unter dem Eindruck der weltweiten Corona-Pandemie in der ersten Hälfte des Jahres 2020 entstanden, welche das Berufs- und Privatleben vieler, besonders aber auch das Bildungswesen sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe gestellt hat. Auch die Forderung einer besonderen Kritikfähigkeit wurde dabei von Verschwörungsgläubigen immer wieder eingefordert. Ein Beispiel aus dem Zeitraum: Abiturienten meiner Frau förderten zu einem gewünschten Alltagsbezug in ihrer Aufgabenstellung im mündlichen Abitur ernsthaft einschlägige Verschwörungstheorien zu Tage, die sie über soziale Medien rezipiert hatten. Dieses „kritische Bewusstsein“ in seiner – derart ausgestaltet – sprachlos machenden Naivität hat natürlich nichts mit den Prinzipien von Critical Literacy oder Critical Pedagogy zu tun, wie sie grundlegend für die Beiträge in diesem Sammelband sind. Dieses kleine Beispiel zeigt jedoch, wie wichtig Wissen in unserer Gesellschaft geworden ist (und immer schon war) und dass Schule den kritischen Umgang mit Wissen und seiner Herstellung unbedingt fördern muss.
Danksagung
Ich danke allen Beitragenden für die große Bereitschaft mitzuwirken, ihre zuverlässige Zusammenarbeit und die fundierten sowie vielschichtigen Beiträge, die für diesen Band zusammengekommen sind. Mareen Lüke danke ich für ihre Unterstützung bei der inhaltlichen und formalen Begutachtung, Kathrin Heyng und Katharina Gerhardt vom Narr-Verlag für das sorgfältige Lektorat sowie ihre bereitwillige Unterstützung für dieses Projekt.
David Gerlach
Marburg im August 2020
Ausgewählte Materialien für einen kritisch orientierten Fremdsprachenunterricht: Jugendliteratur mit Transgender-Thematik
Jan-Erik Leonhardt & Britta Viebrock
1. Einleitung
Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Diskussion ausgewählter Materialien für einen kritisch orientierten Fremdsprachenunterricht. Zwar mag man zunächst meinen, dass der Ansatz kritischer Theorien und Pädagogiken, die einem ebenso orientierten Fremdsprachenunterricht zugrunde liegen, eher eine grundsätzliche Haltung oder Einstellung zur Bedeutung und Gestaltung institutioneller Bildung einfordert, die über die Grenzen eines einzelnen Unterrichtsfachs hinausgeht. Zudem mag man meinen, dass sich ein kritischer Ansatz nicht in einzelnen Materialien oder spezifischen Methoden widerspiegelt. Oder anders herum gesagt: Er ließe sich mit allen möglichen Materialien realisieren, weil es auf die jeweilige Fragestellung und den methodischen oder analytischen Zugriff ankommt. Aber die Themen- und Materialauswahl, an der der sich Bildungsprozesse vollziehen sollen, und der methodische Zugang, mit dem dieses geschieht, sind eben doch nicht trivial und transportieren bereits eine bestimmte Haltung der Lehrenden, die für einen kritischen Ansatz im Fremdsprachenunterricht eher förderlich ist – oder eben nicht. In jedem Fall ist diese Auswahl politisch, selbst wenn sie nicht als solche intendiert ist (vgl. Jeyaraj/Harland 2016: 6).
In diesem Beitrag entfalten wir unsere Überlegungen daher am Beispiel ausgewählter, aktueller Jugendliteratur zu Transgender-Themen, die wir in unseren fremdsprachendidaktischen Seminaren in der Lehrer*innenbildung in Gänze oder auszugsweise wiederholt eingesetzt haben, und adressieren damit auch eine wichtige Frage kritischer Ansätze, nämlich wessen Stimmen (vermittelt über literarische Repräsentationen) im Unterricht hörbar gemacht werden. Vertieft betrachten wir den Roman Symptons of Being Human (Jeff Garvin 2016) und ziehen als Vergleichshorizonte George (Alex Gino 2015), If I Was Your Girl (Meredith Russo 2016) und The Art Of Being Normal (Lisa Williamson 2015) heran. Vielmehr als um die Begründung eines bestimmten Genres oder einer bestimmten thematischen Ausrichtung geht es uns allerdings um ein Plädoyer für eine Vielfalt der Textauswahl (vgl. hierzu auch Kirchhoff 2019), die kontext- und situationsspezifisch sehr unterschiedlich sein kann und die von Schüler*innen auch im emanzipatorischen Sinne mitbestimmt werden kann (vgl. Akbari 2008: 280). Wir wählen hier die genannten literarischen Texte zu Transgender-Themen, weil an ihnen Fragen der sprachlichen Repräsentation (z.B. die Verwendung von Pronomina oder spezifisch männlichen oder weiblichen Vornamen bzw. solchen, die eine schnelle und eindeutige Zuordnung unmöglich machen) und damit verbundene Machtstrukturen exemplarisch verdeutlicht werden können und sich hiermit zentrale Anliegen kritischer Ansätze besonders gut sichtbar machen lassen. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass nicht auch andere Genres und Textsorten, wie z.B. Film (vgl. Viebrock 2016 zu Spielfilmen; Leonhardt et al. 2020 zu Dokumentarfilmen) und Themen wie Werbung (vgl. Fehling 2010) oder die Repräsentation ethnischer oder genderbezogener Aspekte in Lehrbüchern und anderem Unterrichtsmaterial (vgl. Gray 2002) im Rahmen eines kritisch orientierten Fremdsprachenunterrichts ebenso geeignet sein können.
Bevor wir im Folgenden dezidierte Überlegungen zu unseren ausgewählten Materialien anstellen (vgl. Abschnitte 4 und 5), nehmen wir zunächst eine kritische Perspektivierung der Gegenstände des Fremdsprachenunterrichts (Sprache, Literatur, Cultural Studies ) vor (Abschnitt 2). Ebenso beleuchten wir die pädagogischen Perspektiven auf einen kritischen Fremdsprachenunterricht (Abschnitt 3) und leiten daraus grundsätzliche Implikationen ab, was Methoden, Materialien und Aufgabenstellungen betrifft. Diese exemplifizieren wir an einzelnen Aspekten aus den genannten Jugendromanen, bevor wir die Überlegungen in einem abschließenden Fazit (Abschnitt 6) zusammenführen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kritische Fremdsprachendidaktik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kritische Fremdsprachendidaktik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kritische Fremdsprachendidaktik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.