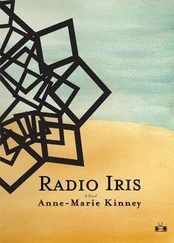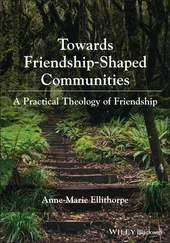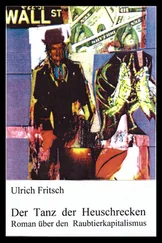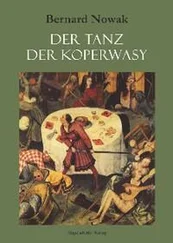Den umstehenden Mitreisenden erklärte er lautstark, ich könne der Partitur lesend entnehmen, was ich nicht in der Lage sei zu spielen. «Denn mit diesen Fingern da ...» Er deutete auf mich, und die Leute glotzten.
Ich erklärte ihm, dass ich die Musikstücke, die meine Finger trotz ihrer Geschmeidigkeit nicht bewältigten, einfach umschreiben würde.
«Umschreiben!»
Siegesgewiss ließ er seinen Blick schweifen.
«Hat man so was schon gehört. Er schreibt sie um!»
Vor lauter Begeisterung schaute er mir nicht in die Augen, sondern durch mich hindurch, vermutlich bereits die Zukunft vor Augen, in der ich als musikalischer Clown sein Zugpferd sein würde.
Während ich ihn in Augenschein nahm, wurde mir leichter ums Herz. Ich bemerkte sein unschönes, mageres Gesicht mit der fliehenden unteren Hälfte, die schiefen, imbezilen Augen über den grotesk hervorspringenden Wangenknochen und die niedrige Schimpansenstirn. Ich wurde richtig glücklich über mein eigenes Aussehen.
«Was für Instrumente spielen Sie, Herr Tyge?», fragte er, während ihm der Speichel aus den Mundwinkeln quoll.
«Klavier und Violine», antwortete ich bereitwillig.
«Eine doppelte Merkwürdigkeit der Natur», klang es aus seinem Mund, während er spontan die Schlagzeile für das Werbeplakat verfasste:
«Zwerg und Musikgenie – ein Vergnügen für alle.»
«Ich besitze nicht das geringste komische Talent, Herr Labri», verteidigte ich mich.
Seine niedrige Stirn verschwand vollständig unter Haaren und Brauen, bevor er in schallendes Gelächter ausbrach. Dies nahm seinen Mund dermaßen in Anspruch, dass es eine Weile dauerte, bis er die pfiffige Frage hervorbringen konnte, die ihn so sehr amüsierte: Ob ich mich denn noch nie im Spiegel betrachtet hätte.
Das habe ich sehr wohl, und ich wiederhole diese Prozedur täglich beim Friseur. Der Anblick betrübt mich nicht. An die breite Stirn habe ich mich längst gewöhnt, ebenso an die eingefallene Stelle zwischen den Augen, die kurze, runde Nase, die man als Sattelnase bezeichnet, meinen riesigen Kiefer und das große Kinn. Meine aschblonden Haare sind kurz geschnitten, damit der Umfang meines Kopfes weniger auffällt. Meine Männlichkeit unterstreiche ich durch einen mit der Zeit ziemlich dicht gewordenen Spitzbart, der mein Kinn schmaler wirken lässt.
Nicht einmal der Anblick meines gesamten Körpers erschreckt mich. Als Kind stand ich oft neben den Pfauen, wenn sie durch die geöffnete Tür direkt aus dem Garten hereinspazierten, und betrachtete mich in den Empirespiegeln.
Zwar bemerkte ich, dass Oberarme und Schenkel im Verhältnis zum Körper zu kurz waren. Aber deswegen fühlte ich mich in meinem Körper nicht weniger wohl. Mein Körperbau war schon damals muskulös. Ich hatte viel Kraft, und wenn mich jemand belästigte, machte ich auch davon Gebrauch. Einen Ansatz von Dickleibigkeit habe ich mir nie gestattet. Überhaupt ist mein Körper von frühester Kindheit an von Europas führenden Experten auf diesem Gebiet mit der größten Sorgfalt untersucht und behandelt worden. Daher bin ich, objektiv betrachtet, ein ungewöhnlich gut aussehendes Exemplar eines Achondroplasie heimgesuchten Menschen. Meine Augen sind braun und strahlen eine wache Intelligenz aus. Auch die Geschlechtsorgane sind von normaler Größe und voll funktionsfähig.
In den späteren Jahren meines Heranwachsens oder besser gesagt der Zeit der allgemeinen Persönlichkeitsbildung – als Vierzehnjähriger wurde ich in einem Kopenhagener Pensionat einquartiert, und es war mir, vom Schulbesuch abgesehen, freigestellt, womit ich meine Zeit verbrachte –, beschäftigte ich mich intensiv mit dem Begriff des Nanismus und nutzte jede Gelegenheit, meine wenigen gleich gearteten Mitmenschen unter die Lupe zu nehmen.
Damals stand ich oft im staatlichen Kunstmuseum vor Karel van Manders Gemälde von Giacomo Favorchi, dem italienischen Zwerg des sächsischen Kurfürsten, das ich grenzenlos bewunderte. Der Maler hat den Zwerg neben eine große dänische Dogge gestellt, deren leicht vorgebeugter Kopf ihm bis zur Mitte der Stirn reicht, aber das macht nichts, seine Ausstrahlung ist imposant. Die rechte Hand hat er in die Seite gestemmt, während die linke das Hundehalsband hält.
Giacomo oder Jacob, wie ich ihn nannte, ist ein attraktiver und selbstbewusster Herr mit schulterlangen Haaren, einem langen Bart und entblößten Armen. Ihm fühle ich mich verbunden, und ich bewundere seinen Geschmack, was die Kleidung betrifft: Puffärmel verdecken die extrem kurzen Oberarme, und weiße Pluderhosen aus kräftigem Velours überspielen seine besonders stark ausgeprägte O-Beinigkeit.
Alle Züge, die für meine Form der Zwergwüchsigkeit charakteristisch sind, besitze ich in Reinkultur. Sie ist primordial und die Folge eines nicht näher bekannten Defekts der Erbanlagen. Die Bekanntschaft mit dem durch und durch eitlen Zwerg des Kurfürsten war für mich von immenser Bedeutung.
Alle Menschen und Pfauen sind eitel. Ich bin da ebenso wenig eine Ausnahme wie Favorchi. Im gegebenen Rahmen achte ich auf mein Äußeres. Es gibt Tage, an denen ich dem Spiegel des Friseursalons zürne, so wie andere Menschen und die Pfauen auch. Manchmal machten die Tiere aus Verärgerung darüber, was sie sahen, bei uns auf den Teppich. Es waren die Männchen, die sich mit erhobener Schwanzfeder besonders in Positur stellten, weil sie glaubten, einen Rivalen vor sich zu haben.
Man gewöhnt sich daran, nicht den übrigen Mitgliedern seiner Familie zu gleichen, wohl aber frappierende Ähnlichkeit mit einem Clan in der Welt verstreuter Gnome aufzuweisen: plattfüßig, leicht o-beinig, mit fleischigen Gesäßbacken, einem Hohlrücken und der so genannten Dreizackhand, was bedeutet, dass die drei mittleren Finger gleich lang sind. Eine Familie, als deren Mitglied mich Herr Labri offensichtlich betrachtete.
Mein Vater, der mich auf dieser Reise begleitete, war für einen Augenblick draußen gewesen und kehrte in dem Moment zurück in den Salon, als das Lachen des Gauklerkönigs verebbte.
Er ist eine imposante Erscheinung und sieht aus, als habe er gerade noch rechtzeitig die Säulenhalle der stoischen Schule verlassen, bevor er selbst zu einer tragenden Säule wurde.
Der Gauklerkönig blickte ungläubig zu dem stattlichen Herrn auf, der ihn mit einem liebenswürdigen Nicken begrüßte und sich nicht darum scherte, ob er ein König oder Bettler war. Labris Blick wanderte zu mir. Das amüsierte Glühen seines Gesichts verwandelte sich in Schamesröte. Grußlos sprang er auf und verschwand in eine Richtung, die ihn sofort aus dem Gesichtsfeld meines Vaters entfernte.
Ich blickte ihm nach und erkannte, dass dieser Pfiffikus nichts als ein kleiner Dreckskerl war.
«Wo waren wir stehen geblieben?», fragte mein Vater voller Elan und setzte sich, als hätte es keine andere Unterbrechung als die seiner Abwesenheit gegeben.
Wir sprachen über Tschaikowski. Mein Vater hatte Kopenhagen besucht, um sich am Königlichen Theater Eugene Onegin anzusehen – eine bessere Inszenierung, da waren wir uns einig, als die, welche wir im Jahr meines Studienbeginns in Berlin erlebt hatten. Die Aufführung fand zu einem günstigen Zeitpunkt statt, sodass wir gemeinsam nach Hause fahren konnten. Ich hatte meine verschiedenen Verpflichtungen erledigt und sah einem langen Sommerurlaub entgegen.
«Als deine Mutter und ich dreiundneunzig Jolanthe am Königlichen Theater gesehen haben ... Tschaikowskis Todesjahr übrigens, wusstest du das? Er wurde nur dreiundfünfzig Jahre alt ...»
Er beugte sich geschäftig über den Tisch, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich nickte zerstreut, aber es ging mir wie so oft, wenn er doziert – ich vergesse zuzuhören. Die Jahreszahl lenkte mich ab. Ich war damals drei Jahre alt, es war Winter, ich konnte vermutlich noch nicht laufen.
Читать дальше