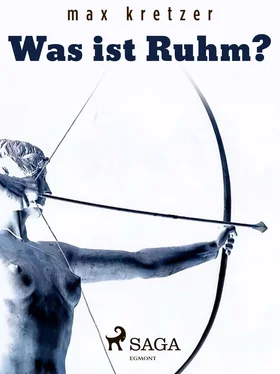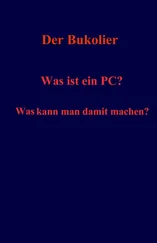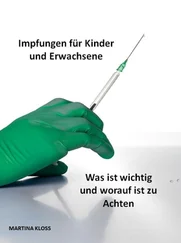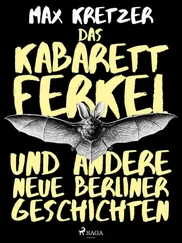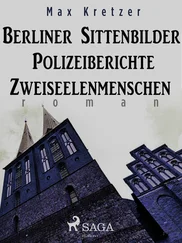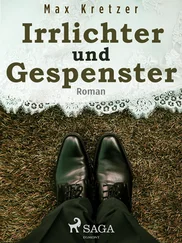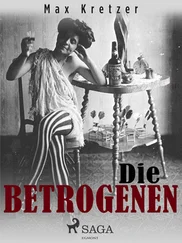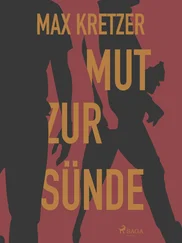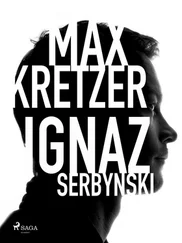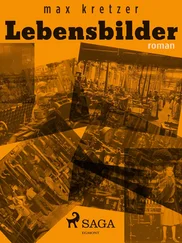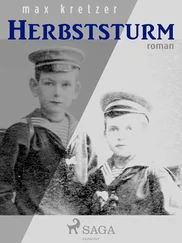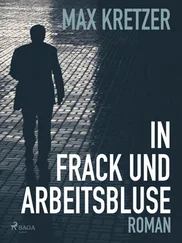Eines Tages tauchte Lorensen wieder vor ihm auf, der endlich seinen Vater breit geschlagen hatte und nun zu seiner weiteren Ausbildung auf dem Wege nach Berlin war. Als er die Kunstversuche des Freundes erblickte, in denen bereits die Klaue des Löwen sich zeigte, fand er zuerst vor Erstaunen weiter nichts als sein berühmtes: „Das ist furchtbar echt;“ dann aber war es für ihn eine ausgemachte Sache, dass Hermann sofort die Tretmühle verlassen müsse, um mit ihm zu fahren. Es wäre eine Sünde, ein Verbrechen an der heiligen Kunst, wenn er sein Talent verkümmern liesse! In Berlin würden sie sich schon durchstümpern, und er leiste einen Schwur, alles mit ihm zu teilen.
Er hatte bare dreihundert Mark in der Tasche, und so machte er mit seinem Versprechen gleich den Anfang. Für die Mutter Kempens wurde der Unterhalt auf einen Monat im voraus bestritten, was Hermann gern annahm, denn er hatte sich im Augenblick auch ferner sein festes Ziel gesteckt: in Berlin neben der Kunst die Arbeit nicht zu vergessen. So würde er dem Freunde bald alles vergelten können.
Sie fuhren also los, hinein in die verschleierte Zukunft.
Ein Jahr lang besuchten sie die Modellierklasse der Berliner Akademie, bis dann Lorensen in ein Meisteratelier ging, während Kempen der Gehilfe eines alten Bildhauers wurde, der zeitweilig von seinen vielgenannten Kollegen Aufträge erhielt, die er allein in seiner Scheune aber nicht bewältigen konnte. Der verschlossene Hamburger, der bereits bärtig wie ein Vierzigjähriger war und sich ein wenig unter den Jünglingen genierte, hatte bald herausbekommen, dass die akademischen Formen nicht für ihn geschaffen seien, und so klopfte er bei Walzmann an, dem halb verkommenen Genie, der nur arbeitete, wenn er Geld brauchte, die übrige Zeit sich jedoch dem Alkohol ergab. Hier konnte Kempen lernen und dabei auch verdienen, denn in der Heimat sass noch immer das Mütterchen, das von den Sorgen des Sohnes nichts erfahren durfte. In solchen Arbeitswochen blieb Walzmann durchaus nüchtern; er schloss sich dann in seinem „Müllkasten“, wie er das Atelier nannte, gänzlich von der Aussenwelt ab, um die Lieferungsverträge pünktlich innehalten zu können, die seine Auftraggeber mit ihm gemacht hatten. Ein gewisser Paragraph brachte ihn um einen Teil seines Lohnes, sobald er rückfällig zu werden drohte; und das gab ihm die jämmerliche Kraft, in Enthaltsamkeit auszuharren.
Während Lorensen zu einem Professor ging, um sorgsam eine Sprosse der Kunstleiter nach der andren zu nehmen, machte sich Kempen an jedem Morgen in aller Frühe wie ein Handwerker auf den Weg, um erst des Abends auf der gemeinsamen Bude mit dem Freunde zusammenzutreffen; und gleich einem Scharwerker brachte er an jedem Sonnabend seinen Lohn nach Hause, der dazu beitrug, die beiden notdürftig über Wasser zu halten, denn Lorensens Vater konnte nur einen geringen Zuschuss leisten.
So standen die Dinge, als die Freunde sich genötigt sahen, ihre Wohnung in der Nähe des Schiffbauerdammes aufzugeben, nachdem ihr dortiger Wirt, ein Kellner, erklärt hatte, die „Schweinerei“ nicht mehr ertragen zu können. Lorensen war allerdings in der Ausnutzung des Hofzimmers in letzter Zeit ein wenig zu weit gegangen. Eines Sonntags, in den Ferien, während Kempen im Zoologischen Garten weilte, um Löwenstudien zu treiben, hatte er sich ein bekanntes weibliches Modell der Akademie kommen lassen und ungeniert seine „Eva in Scham erglüht“ lebensgross zu modellieren begonnen. Das war der Ehehälfte des biederen Serviettenschwenkers zu viel, da sie sich obendrein in ihren Reizen zurückgesetzt fühlte. Sie schlug Lärm bei ihrem Manne, und die Folge davon war, dass der zum Leben erweckte Ton wieder sein feuchtes Klumpendasein führen durfte und die Stubengenossen nach einer gastlichen Stätte für ihren Ehrgeiz sich umsehen mussten. Da es bei Meister Walzmann nichts mehr zu tun gab, so machte Kempen den Vorschlag, die vierzehn Tage bis zum Umzug in der Heimat zu verbringen, wogegen Lorensen nichts einzuwenden hatte, schon aus praktischen Gründen, weil das Leben zu Hause nichts kostete.
Frisch gestärkt, mit gebräunten Wangen, war man wieder zurückgekehrt, hatte sich einen Wagen geliehen und die kühne Fahrt nach dem Westen gemacht.
Gleich am Abend des zweiten Tages fanden sich sonderbare Gestalten bei ihnen ein, um die neue Bude einweihen zu helfen. Als erster klopfte Schmarr an, ein kleiner verwachsener Mann mit einem auffallend grossen Kopf, der stets eine Satyre bereit hatte, sobald der breite Mund mit den schlechten Zähnen sich öffnete. „Na, wollt Ihr Eure Ehe immer noch fortsetzen?“ fragte er sogleich mit einer Anspielung auf die bereits sprichwörtlich gewordene Unzertrennlichkeit der beiden und reichte jedem von ihnen seine lange Pfote, die dürr und knochig aus dem zu kurzen Ärmel ragte.
Dieser von der Natur so stiefmütterlich behandelte Mensch, der fast hässlich wirkte, aber wunderschöne, grosse Augen hatte, suchte etwas darin, seiner Kleidung einen kokett-künstlerischen Anstrich zu geben, was sich namentlich in den bunten, auffallend punktierten Selbstbindern zeigte, deren geschwungene Schleifen schmetterlingsartig in riesiger Ausdehnung auf dem Rockkragen lagen. „Ich hörte doch irgendwo, Ihr wolltet Euch endlich scheiden lassen, weil Kempen Absichten auf seine alte Waschfrau habe. Junges Gemüse hat ihm ja nie geschmeckt.“
Um seine Witze anzubringen, erdichtete er immer das Hörensagen. Kempen brummte nach seiner Gewohnheit, Lorensen jedoch lachte hell auf, angesteckt von der Lustigkeit, die dieser Spötter immer hereinbrachte, dessen eigentlich tiefes Gemüt in köstlichen Kindergruppen zum Ausdruck kam, die sozusagen seine Spezialität waren. Seine Doppelbüste „Singende Knaben“ hatte ihm ein Studienjahr nach Rom eingetragen, von dem er noch immer wie ein Weltreisender zehrte. Dreimal war diese Gruppe von ihm verkauft worden, was mit einem gewissen Zunftstolz von seinen Freunden erzählt wurde.
Maler Blankert, dünn und hochaufgeschossen, umschlottert von seinem ewigen Pelerinenmantel, für den, weil er viel zu kurz und zu eng war, Lorensen die Bezeichnung „Talentwindel“ erfunden hatte, meldete sich zugleich mit dem beweglichen, unverwüstlichen Musiker Nuschke, der, kaum die Tür hinter sich, einen täuschend ähnlichen Trompetentusch hervorbrachte und dann seine Gelenkigkeit bewies, indem er mit dem rechten Bein über eine Stuhllehne setzte. Ein sogenanntes verrücktes Huhn, besass er die Gabe, die verschiedensten Instrumente nachzuahmen, was namentlich zwerchfellerschütternd wirkte, wenn er die Klarinette dudelte.
Beide wurden mit einem Halloh empfangen. „Ja, Kinder, habt Ihr denn immer noch kein Klavier?“ fragte Nuschke sofort, was er jedesmal tat, sobald er die Bildhauer besuchte. „Das wird ja bald strafwürdig von Euch. Pfui Teufel, seid Ihr unmusikalische Menschen. Ihr geht in kein Konzert, in keine Oper, und wenn ich Euch dann mal ein bisschen Schliff durch meine neueste Komposition beibringen will, dann verlangt Ihr, ich soll die Suppe bei Euch blasen; und die gibt’s nicht mal. Schmarr, ist das ’ne Gesellschaft, was? Gipsbolzen sind’s. Ton kennen sie, aber an Gefühl für Töne mangelts.“
Und während der Verwachsene wieherte vor Wonne, prüfte Nuschke, der stets patent gekleidet ging, vorsichtig die Stühle auf ihre Reinlichkeit, denn wiederholt war es vorgekommen, dass er aus der früheren Bude der beiden sichtbare Zeichen ihres Kunstmaterials mit davongetragen hatte.
„Sag mal, wo schindest du denn jetzt fremde Schlafstellen?“ fragte Blankert den kleinen Bildhauer, von dem alle wussten, dass er, da er kein rechtes Heim hatte, in den Ateliers der Jungen herumnassauerte, wo er bald hier, bald dort etwas modellierte, das er dann zu verkaufen versuchte. „Ich habe mir ein paar Sohlen abgelaufen, um dich zu suchen.“
Читать дальше