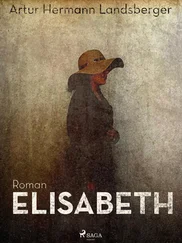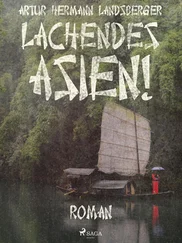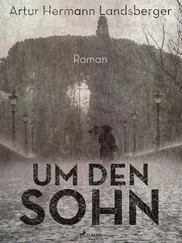„Und mir hast du immer erzählt, es geschähe nur der Kinder wegen.“
„Gewiss! auch! – aber in erster Linie hab’ ich natürlich an mich gedacht. Damit aber, dass wir uns nun hier von allem ausschliessen, habe ich freilich nicht gerechnet.“
„Was das nur heisst,“ erwiderte Leopold und schlug eins der grossen Bücher auf. – „Hier überzeug dich selbst. In Neutomischel haben wir im letzten Jahre Siebentausendvierhundert Mark gebraucht und in Berlin im ersten Jahre weit über Vierzigtausend. Das ist das sechsfache.“
„Im Verhältnis von Berlin zu Neutomischel ist es die Hälfte! verlass dich drauf!“
Leopold nahm den Zettel, den ihm Emilie gegeben hatte, vom Schreibtisch auf und sagte:
„Und dieses Wochenprogramm beweist auch nicht gerade, dass wir uns von allem ausschliessen – im Gegenteil! Vielmehr liegen die Dinge so, dass wir ruiniert sind, wenn wir weiterhin alles mitmachen, statt uns einzuschränken.
Emilie glitt auf den Sessel, der ihr am nächsten stand.
„Einschränken ...“ wiederholte sie tonlos: – „wo man eben anfangen wollte, zu leben.“
„Es tut niemandem mehr leid, als mir;“ lenkte Leopold ein. „Ich hatte es mir auch anders gedacht.“
„Mit deinem Mitleid änderst du nichts.“
„Gewiss nicht!“
„Also wirst du wohl andre Mittel suchen müssen, um zu Geld zu kommen.“
„Es gibt keine!“
„So reden Feiglinge und Krämer! Wenn es so nicht geht, so versuche es ... in Kupfer ... oder in Getreide ... oder an der Börse ... oder, was weiss ich – jedenfalls wird es doch noch etwas andres auf der Welt als Buckskin geben!“
„Und meine Bestände?“ fragte Leopold.
„Was für Bestände?“
„Nu, mein Lager, – allein in Kommissionswaren hab’ ich für über achtzigtausend Mark Ware liegen.“
„Such’ die an Papa in Neutomischel loszuwerden; darin hast du doch Uebung.“
„Meinst du, der hat nicht längst gemerkt, wie wir ihn bei der Separation übers Ohr gehauen haben?“
„Sag’ ruhig: betrogen haben!“ ergänzte Emilie. „Wir brauchen einander doch nichts vorzumachen.“
„Nenn’s, wie du willst; jedenfalls wird er ein zweites Mal vorsichtiger sein.“
„Nicht einmal soviel traust du dir zu, mit einem Manne von zweiundsiebzig Jahren, der noch dazu dein Schwiegervater ist, fertig zu werden?“
„Würde es dir etwa passen, wenn ich den alten Mann zugrunde richte?“
„Was das für Redensarten sind!“ erwiderte Emilie; „wer spricht denn von zugrunde richten? Es ist doch selbstverständlich, dass ein anderer verlieren muss, wenn du gewinnen willst. – Also mach was du willst; jedenfalls ist es deine Pflicht, für einen standesgemässen Unterhalt deiner Familie zu sorgen. Wie du das machst, ist deine Sache!“
Die grosse Chance
„Grossvater kommt!“ stürzte Jette ins Wohnzimmer, in dem Leopold und Emilie beim Nachmittagskaffee sassen.
„Was für’n Grossvater?“ fragten beide.
„Unser! – unser – unser!“ rief Jette – und war auch schon wieder draussen, riss die Korridortür auf und lief dem alten Manne entgegen.
Leopold und Emilie sahen sich an.
Gleich darauf hörte man eine laute Männerstimme; – ganz deutlich, da Jette in ihrer Erregung sämtliche Türen offen gelassen hatte.
„Wahrhaftig!“ sagte Leopold, „er ist’s!“
„Sehr unnötig!“ erwiderte Emilie verstimmt.
„Immerhin ...,“ meinte Leopold.
„Was heisst das?“ fragte sie.
„Nun, immerhin ist es dein Vater.“
„Wenn schon! – aber willst du mir vielleicht sagen, was ich hier mit ihm anfangen soll?“
„Das möchte ich auch wissen!“ erwiderte Leopold. „Wenn du wenigstens den Jacoby nicht fortgeschickt hättest.“
„Ich habe fortgeschickt?“ fragte Leopold erstaunt.
„Etwa nich?“ erwiderte Emilie. „Sonst wäre er doch da! – Wenn du nur immer auf mich hören wolltest!“
Und als Leopold sie ganz erstaunt ansah, sagte sie:
„Ich erinnere mich genau, dass ich dir geraten habe, ihn zu halten, wenn du ’n brauchst.“
„Meinetwegen,“ lenkte Leopold ein, „es ist ja nun auch gleich, wer ihn fortgeschickt hat.“
Leopold sah zur Tür; draussen hörte man deutlich eine Männerstimme.
„Wenn er sich wenigstens angemeldet hätte!“ sagte Emilie. „Ich habe jedenfalls keine Zeit, mit ihm herumzulaufen.“
„Ich glaube“ – sagte Leopold und machte eine Bewegung, als wenn er aufstehen wollte – „wir müssen ....“
„Ja!“ erwiderte Emilie und erhob sich. „Was er nur will?“
Auch Leopold stand jetzt auf.
„Ich kann mir schon denken!“ sagte er.
In diesem Augenblick trat Cohn ins Zimmer.
„Da seid ihr ja, Kinder,“ begrüsste er sie; gab Emilien einen Kuss auf die Stirn und drückte Leopold die Hand.
„Nun, euch braucht man nicht zu fragen, wie’s euch geht!“ sagte er ... „Ihr seht ja glänzend aus.“
„Es ist der reine Zufall, dass du uns antriffst,“ sagte Emilie.
„Sooo? – Wolltet ihr fort?“ fragte Cohn. „Ich will euch nicht stören. Was ich habe, is in ’ner halben Stunde erledigt. ’S Geschäft geht vor.“
„Wir wollten mit einer befreundeten Kommerzienratsfamilie auf acht Tage ins Riesengebirge!“ protzte Emilie.
„Gott behüte!“ rief Cohn, „bei die Kälte.“
Emilie lachte verächtlich.
„Im August kann man nicht Ski laufen.“
„Was ist das?“ – fragte Cohn, „wozu tut man das?“
„Zum Vergnügen!“ erwiderte Emilie, „und um schlank zu bleiben.“
„Recht habt ihr,“ sagte Cohn. „Wenn ihr’s euch leisten könnt. – Nehmt ihr’n Jacoby natürlich mit?“
„Wen?“ fragte Emilie.
Cohn sah sie gross an, dann lachte er und sagte:
„Kennt ihr’n Jacoby nich?“
„Ach so – ja – Leopolds früheren Buchhalter.“
„Früheren? – was heisst das?“ fragte er ganz bestürzt.
Leopold hat ihn entlassen.
„Entlassen? – den Jacoby?“
„Seine Leistungen genügten ihm nicht mehr.“
„Ja, was, was fängt der Mensch nun an?“ – Cohn war ganz ausser sich.
„Unsre Sorge!“ sagte Emilie.
„Ihr habt’n doch mit euch nach Berlin genommen – von selbst wäre er nie von Hause fortgegangen.“
„Er ist ’n ausgewachsener Mensch, der wissen muss, was er tut – und sich nicht mitnehmen lässt,“ erwiderte Leopold.
„Oder sollten wir ihn etwa lebenslänglich durchfüttern?“
Cohn machte ein sehr verdriessliches Gesicht.
„Wie lange ist er fort von euch?“ fragte er.
„Seit ein paar Tagen,“ erwiderte Leopold.
„Wenn er nichts anderes findet – und er wird nichts finden, davon bin ich überzeugt, – dann werde ich ihn wieder zu mir nehmen.“
„Hast du denn Verwendung für ihn?“ fragte Leopold.
Cohn dachte nach.
„Nein,“ sagte er. „Verwendung habe ich nicht; im Gegenteil, ich muss mit jedem Groschen rechnen; – aber, was hilft’s, man kann ihn doch nicht hungern lassen, wo er fünfzehn Jahre lang bei einem war, – man kann überhaupt keinen Menschen hungern lassen!“ fügte er hinzu.
„Das sind rückständige Ansichten, Papa!“ sagte Emilie.
„Jedenfalls denkt hier kein Mensch so!“ stimmte Leopold bei.
„Ich leb’ ja nicht hier!“ erwiderte Cohn, – „möcht’ hier auch nicht leben, wenn so was möglich is.“ Dann wandte er sich an Emilie. „Und nun lass mich mal auf eine halbe Stunde mit deinem Mann allein. Ich habe was Geschäftliches mit ihm zu bereden.“
„Was Unangenehmes natürlich“, sagte Emilie.
„Wieso?“ – fragte Cohn; „im Gegenteil! Was äusserst Angenehmes; vorausgesetzt, dass es sich machen lässt! Aber es wird sich schon machen lassen!“
Читать дальше