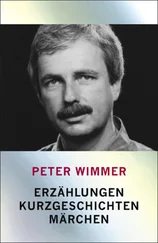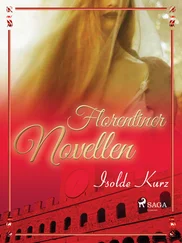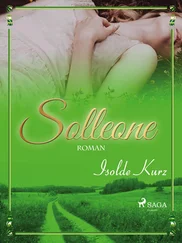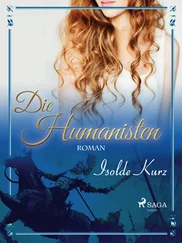Die lauten Tritte und Stimmen verhallten, und die Liebenden sahen sich allein in der blumigen Stille. Über die Terrasse wehten die langen, kühlen Atemzüge der Nacht wie eine Botschaft der großen freien Natur, daß das Reich menschlicher Konvention zu Ende sei.
Lydia lachte nicht mehr, ihr Gesicht nahm einen bangen, fast erschrockenen Ausdruck an. Paul strich ihr das herabgefallene Haar aus der Stirn, und da er noch einen Rest Champagner in seinem Glase fand, nötigte er sie, ihn auszutrinken. Sie lehnten ihre Stirnen gegeneinander, und in dem tiefen, feierlichen Schweigen, das auf all den Lärm folgte, war nichts mehr zu hören als die bewegten Atemzüge der beiden.
Ein verwegener Gedanke ging durch Pauls Hirn.
Sie behalten, an sich reißen, gleich jetzt, mit ihr davongehen, ohne Papiere und Standesbeamten, und der Familie Esselin schreiben, daß er die Lydia nicht mehr hergebe. Mochten sie immerhin Gesichter machen, was brauchte er sich darum zu kümmern. Hatte er nicht auch wie die andern ein Recht an Glück!
Da fiel ein Glockenschlag, und sie fuhren beide auseinander.
„Es wird spät“, sagte Lydia zaghaft, und da er nicht widersprach, setzte sie hinzu: „Ich muß gehen.“
Paul wußte nicht, was der eine Schlag bedeutete, denn er trug keine Uhr, aber der Ton der Glocke hatte ihn zurückgerufen in die nüchterne Wirklichkeit. Alle Rücksichten und Bedenklichkeiten, die bisher sein Leben bestimmt hatten, traten wieder in ihre Rechte. Die Lampe, die, vor Zugluft geschützt, dort in der Ecke stand, war tief heruntergebrannt, und eine Unzahl winziger brauner Mücklein bildeten mit ihren Leibern eine fingerdicke Schicht auf dem Glase. Paul sah nach dem Himmel, von dem ein breites Stück sich hoch über den Nachbardächern ausspannte: Arkturus flimmerte schon rötlich und begann zu sinken. Da seufzte er: „Ja, es ist spät, ich muß dich nach Hause bringen.“
Auf dem Heimweg eilte Lydia, als ob eine Gefahr in ihrem Rücken bleibe, und jeder Glockenschlag, den sie hörte, beflügelte noch ihren Schritt. Es war eine der wunderbaren südlichen Sommernächte, wo die tausend Stimmen der Natur in einen einzigen, langgezogenen Ton zusammenfließen, als ob die Nacht mit leiser Musik ihren Gang begleite. Paul Andersen wollte zuweilen stehenbleiben und unter der unermeßlichen Sternenfülle einen tieferen Atemzug nehmen, aber Lydia zog ihn hastig weiter. Eine halbe Stunde später standen sie vor dem Parkgitter der Esselinschen Villa. Lydia hatte den Schlüssel, und ihr Verlobter schloß auf. Noch ein Kuß, ein flüchtiger, letzter! — Halte sie fest, sagte abermals eine Stimme in ihm, aber im nächsten Augenblick war sie ihm schon entglitten, entschwebt wie ein Phantom, und innen verhallten ihre Schritte auf dem Kiesweg.
Paul stand noch und starrte durch das Gitter. Eine unbegreifliche Menge von Leuchtkäfern füllte ringsum die Luft, sie waren überall, auf den Feldern da unten und oben auf dem Weg, aber drinnen im Esselinschen Park waren sie am zahlreichsten. Wie spritzende Funken stoben sie durcheinander und gaben dem nächtlichen Garten ein seltsames, märchenhaftes Ansehen. Ach, sie hatten gut schwärmen, ihr Leben und ihre Liebe verglühten beide in einem Freudenfeuer, für sie gab es kein Morgen. Warum ist nicht auch das Leben des Menschen solch ein kurzer und glänzender Wonnetraum?
Der Feuerreigen in den Lüften ward immer wilder und leidenschaftlicher, und ab und zu ließ noch die Nachtigall ihren melodischen Ton wie aus dem Schlafe vernehmen. In einem Mauerloch saß ein einsiedlerisches Kiuh, und sein klagender Ruf, der die ganze Nacht nicht verstummt, füllte den einsamen Mann mit einer seltsamen Wehmut. Er stand noch lange und blickte durch das Gitter in sein verschlossenes Paradies, bis er seufzend den Heimweg antrat.
Beim Auskleiden fiel ein Goldstück aus seinem rechten Schuh.
Als Paul Andersen am nächsten Morgen erwachte, war ihm zumute wie einem Menschen, der ein teures Angehöriges verloren hat und den über Nacht der Traum in den Besitz seines Glückes zurücktäuschte; sobald er die Augen öffnet, jählings fällt eine Zentnerlast auf seine Brust, und nun weiß er wieder: es ist ein Leichnam im Hause. Der Bankbruch, das verlorene Gold, der Julius!
Der Kopf war ihm schwer von dem ungewohnten Champagner, aber er erhob sich doch, um nach dem Bild auf der Hobelbank zu sehen und den Besteller zu vertrösten. Da wurde ihm ein Billett der Wirtin gebracht, dessen bloßer Anblick ihn schon beunruhigte.
Sie schrieb, da er sich nun verheirate, sei sie genötigt, ihm den Zins für das nächste Quartal zu erhöhen, denn bei Abschluß des Mietkontrakts habe man den Schaden, der in einem Haus durch Kinder entstehe, nicht in Anschlag gebracht. Er möge ihr baldigst seine Entscheidung mitteilen, da sich bereits ein neuer Mieter für seine Wohnung gefunden habe.
Das fängt gut an, dachte Andersen und eilte mit dem Billett die Treppe hinab, um die Hilfe seines Freundes gegen die geldgierige Hausfrau in Anspruch zu nehmen. Der aber schlief noch fest und war nicht in die Wirklichkeit zurückzurufen. Erst bei Andersens zweitem Besuch ermannte er sich so weit, die Augen zu öffnen, aber an den gestrigen Abend hatte er nur eine ganz verworrene Erinnerung.
„Du und heiraten!“ sagte er. „Sei kein Narr!“ Und damit drehte er sich gähnend nach der Wand.
Der Julius war zwar wieder ganz, und bei Abnahme des Seidenpapiers zeigte sich’s auch, daß die Untermalung nicht gelitten hatte, aber durch das aufgestrichene Fett, das die noch frischen Farben vor dem Ankleben bewahren sollte, waren die Lasuren verdorben. Es blieb nichts übrig, als das Bild frisch zu übermalen, doch als Andersen damit in die Tribuna ging, fand er einen Engländer mit der Staffelei vor dem Original. Durch Vermittlung des Inspektors erhielt er den zweiten Platz, auf dem er jedoch nicht sehen konnte, und die Wiederherstellung des Bildes ging nur langsam vorwärts, während ihm vor Kopfschmerz die Augen fast aus den Höhlen quollen. Nebenbei erfüllte er noch die bittere Pflicht, dem deutschen Freund den Empfang des schon wieder zerronnenen Geldes zu quittieren.
Er fühlte wohl, daß es unzart war, nicht sofort zu Lydia zu eilen, aber er fand keine Zeit, und dann, wie konnte er sich in dieser Verfassung zeigen? Nein, es ging wirklich nicht. Endlich entschloß er sich und griff zur Feder, um sein Ausbleiben zu entschuldigen.
Umgehend kam auch ein Schreiben von ihr, er wußte nicht, ob es eine Antwort auf das seinige war oder ob die beiden Briefe sich gekreuzt hatten.
„Mein Paul“, schrieb sie, „ich weiß, daß du es nicht kannst. Du würdest zu unglücklich sein, in der steten Furcht vor dem morgigen Tage, und ich mit dir. Denn neben einem leichtlebigen Mann würde ich wohl den Sprung ins Unbekannte wagen, aber um uns beide aufrechtzuhalten, dazu reicht meine Kraft nicht aus. Wir haben keine Schuld, wir beide, es liegt im Blut; wer als Schneider geboren ist, wird nimmermehr ein Schuster.
Ich habe mit Frau Esselin gesprochen, sie gibt mich frei, und ich reise morgen nach Hause. Ein Schwager meiner Schwester wirbt seit zwei Jahren um mich, ich habe dir nie davon gesprochen, um dich nicht zu beunruhigen. Er ist ein guter Mensch, der mir verzeihen wird, daß ich ihn nicht lieben kann, und ich will mein Jawort geben, schon um dich von der Besorgnis um meine Zukunft zu befreien.
Mein Geliebter, komme nicht heraus, es ist besser, daß wir uns nicht mehr sehen. Wenn es eine Welt gibt, deren Kreaturen nicht nach Brot schreien, so hoffe ich, dort einmal dich wiederzufinden.“ —
Als Paul diesen Brief gelesen hatte, weinte er wie ein Kind; er fühlte wohl, daß er mit dieser Liebe von zehn Jahren auch seine Jugend zu Grabe trug und daß er fortan verurteilt war, über einem Trümmerhaufen zu leben, aber er sagte sich: „Lydia hat in allem recht.“
Dennoch kam er über viele Fragen nicht hinaus: Warum, dachte er, ist die Welt für den einen ein fettes, immergrünes Weideland und für den andern ewig eine dürre Heide? Ist es am Ende gar nicht dieselbe Welt, bringt vielleicht ein jeder bei seinem Eintritt ins Leben eine eigene Welt mit, die ihn festhält wie die Atmosphäre? Wie kommt es dann, daß ich gestern mit diesen selben Augen in eine andere, so viel grünere blickte und mir eine Zeitlang einbilden konnte, es sei die meine?
Читать дальше