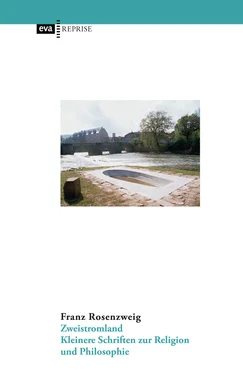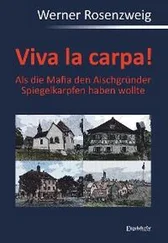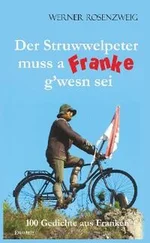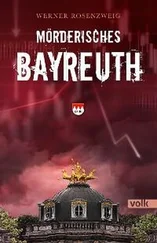Franz Rosenzweig - Zweistromland
Здесь есть возможность читать онлайн «Franz Rosenzweig - Zweistromland» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zweistromland
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zweistromland: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zweistromland»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Zweistromland — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zweistromland», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
So ist der jüdische Mensch, wie ihn die Galuthpolitik des Zionismus allein kennen will, schließlich trotz aller Durchgestaltung im einzelnen, die sie ihm angedeihen lassen möchte, doch etwas durchaus Negatives, etwas sich Abgrenzendes und dadurch selber nur Beschränktes. Die Universalität, die Ganzheit, die auch der Zionismus, wenigstens in seinen reifsten Denkern, dem jüdischen Menschen für wesentlich eigen erkennt, soll ihm erst in einer andern Zeit und an einem andern Ort wiederkommen. Der Zionismus würde sich selber verleugnen, wenn er seiner Galuthpolitik diesen Charakter des Provisoriums nähme. Wer für den Augenblick, das Heute, arbeiten will, ohne die Hauptlast der Arbeit auf ein unsicheres Morgen abzuschieben, der kann darum nicht in den zionistischen Geleisen gehen. Er muß mit dem jüdischen Menschen, dem ganzen in seiner Ganzheit, hier und heute Ernst machen. Aber wie das?
So wie man allein anfangen darf mit allem ganz Großen, mit allem, wovon man gewiß ist, daß es nur allumfassend oder überhaupt nicht sein kann: ganz bescheiden. Was nur auf begrenzten Umfang angelegt ist, das mag man nach begrenztem, klar ausgeführtem Plane errichten, man mag es „organisieren“. Das Unbegrenzte versagt sich der Organisation. Das Fernste läßt sich nur ergreifen beim Nächsten, beim jeweils Nächsten des jeweiligen Augenblicks. Jeder „Plan“ ist hier schon von vornherein falsch, weil er – ein Plan ist. Denn das Höchste läßt sich nicht planen. Ihm gegenüber ist Bereitsein wirklich alles. Nur Bereitsein, nichts anderes können wir dem jüdischen Menschen in uns, den wir meinen, entgegenbringen. Nur den ganz leisen Ruck des Willens – schon im Wort „Willen“ liegt beinahe zu viel; wirklich nur jenen ganz leisen Ruck, den wir uns geben, wenn wir in einer wirren Welt einmal still vor uns hin „wir Juden“ sagen und damit zum ersten Mal jene unendliche Bürgschaft übernehmen, die der alte Spruch meint, der jeden Juden für jeden Bürge sein läßt. Nichts anderes als dieser einfache Entschluß, einmal zu sagen: „nichts Jüdisches ist mir fremd“, wird vorausgesetzt, – auch das wieder kaum ein Entschluß, sondern fast nur ein „kleiner Ruck“, ein Umsich- und Insichschauen. Was der einzelne schauen wird, wer wollte ihm das voraussagen!
Nur so viel wage ich ihm vorauszusagen: er wird das Ganze erschauen. Denn wie es unmöglich ist, das Ganze anders zu erschwingen, als indem man bescheiden beim Nächsten ansetzt, so gilt es doch nun auch umgekehrt, daß es dem Menschen unmöglich ist, das Ganze, das ihm bestimmte Ganze, nicht zu erreichen, wenn er nur wirklich die Kraft zu jenem schlichten, bescheidensten Anfang gefunden hat. Wer einmal sich frei gemacht hat von all jenen albernen Ansprüchen, die ihm das Juden- „tum“ als einen Kanon von bestimmten, abgrenzbaren „jüdischen Pflichten“ – Vulgärorthodoxie –, oder „jüdischen Aufgaben“ – Vulgärzionismus –, oder gar (Gott behüte!) „jüdischen Ideen“ – Vulgärliberalismus – aufdrängen wollen, wer sich ganz einfach bereit gemacht hat, alles was ihm begegnet, von außen und von innen begegnet, seinen Beruf, sein Deutschtum, seine Ehe, und meinetwegen auch, wenn es denn sein muß, sein Juden- „tum“, sich jüdisch begegnen zu lassen, der darf die Gewißheit haben, daß er mit der einfachen Aufsichnahme dieser grenzenlosen „Bürgschaft“ auch wirklich „ganz Jude“ werden wird. Ja, es ist kein andrer Weg, es ganz zu werden. Auf keinem andern Weg entsteht der jüdische Mensch. Alle Rezepte, das orthodoxe wie das zionistische wie das liberale, erzeugen, je rezeptmäßiger sie befolgt werden, um so lächerlichere Karikaturen von Menschen. Und eine Karikatur von Mensch ist auch eine Karikatur des jüdischen Menschen; man kann als Jude das eine nicht vom andern lösen. Es gibt nur das eine Rezept, das den Menschen zum jüdischen und damit, da er Jude ist und also zum jüdischen Leben bestimmt, zum wahren Menschen macht: das Rezept der Rezeptlosigkeit, so wie ichs eben mit – ich fühls! – schwachen Worten zu stammeln versuchte. Unsre Alten haben ein schönes Wort dafür gehabt, worin alles steckt: Vertrauen.
Vertrauen ist das Wort der Bereitschaft, der Bereitschaft, die nicht nach Rezepten fragt, nicht ein „Was soll ich denn nun dann“ und „Wie mache ichs denn“ zwischen den Zähnen hat. Vertrauen erschrickt nicht vor dem Übermorgen. Es lebt im Heute, es geht mit sorglosem Fuße über die Schwelle, die aus dem Heute ins Morgen führt. Vertrauen weiß nur vom Nächsten. Und gerade deshalb gehört ihm das Ganze. Vertrauen geht nur geradeaus. Aber ihm rundet sich unvermerkt die dem Ängstlichen ins Unendliche sich verlierende Straße zum ganz durchmeßbaren und doch unendlichen Kreis.
So brauchts zum jüdischen Menschen nichts als Bereitsein. Wer ihm helfen will, kann ihm nichts geben als die leeren Formen des Bereitseins, leere Formen, die sich von selber und nur von selber füllen dürfen. Wer ihm mehr gibt, gibt ihm weniger. Nur die leeren Formen, in denen etwas geschehen kann, lassen sich bereithalten, nur – „Raum und Zeit“. Wirklich nichts andres als dies: ein Sprechraum, eine Sprechzeit. Das ist das einzige, was sich vorweg „organisieren“ läßt. Also sehr wenig. Sozusagen gar nichts. Unsre neuen jüdischen Zeitschriften, die in den letzten Jahren mehr und mehr einen sprechsaalhaften Charakter annahmen, haben dies Bedürfnis fein herausgefühlt. Sie sind so, insbesondere die beste, der Bubersche Jude, wirklich Mächte in unserem Leben geworden, vielleicht die lebendigsten überhaupt. Die jüdische „Volkshochschulbewegung“ – ein schlechtes Wort, weil es eine unzutreffende Vergleichung mit der deutschen Volkshochschulbewegung heraufbeschwört, die doch ganz andersartige Ziele verfolgen muß – diese neueste und vielleicht wichtigste Bewegung im heutigen deutschen Judentum, muß sich klar werden, was sie will. Sie kann den Weg gehen, den die Berliner Gründung nicht ohne äußern Erfolg beschritten hat: sie kann unter Ausnutzung des schrankenlosen Vortragshungers des Großstadtpublikums versuchen, die ungeheure Lücke im jüdischen Bildungswesen zu stopfen, nachzuholen, was der „Religions“-Unterricht versäumte, was die Universität nicht bietet. Dann wird sie nach Möglichkeit ein komplettes System von Kursen anbieten müssen, einen Lehrplan möglichst enzyklopädischen Charakters, kurzum – Bildung. Und sie wird dann letzten Endes, wie heute die Dinge liegen, beim besten Willen, den sie – im Gegensatz zu dem verkümmerten Unterricht – sicher hat, eben nur Ersatz werden für etwas, was normaler Weise an andrer Stätte gegeben werden sollte und was dort nicht gegeben werden kann, weil die lebendige Kraft fehlt, an der die endlose Bücherwelt der Bildung ihr Ende erfahren müßte und aus der sie daher allein ihren lebendigen bücherlosen Anfang nehmen könnte: der Mittel- und Keimpunkt für das jüdische Leben des jüdischen Menschen.
Oder sie versucht, dieser Punkt zu werden. Sie versucht, die Form, gewiß nur die leere, erste, – nächste Form für ein solches Leben zu sein. Sie versucht, Anfang zu sein. Statt ein planvoll inhaltlich durchgeführtes Ganzes hinzustellen, dem sich die Wißbegierigen nähern, um es schrittweise zu durchmessen – gleichwie auf Universitäten ein im ganzen fertiges, im einzelnen werdendes Gebäude einer Wissenschaft dem Schüler gegenübersteht, etwas was nicht er selber ist, sondern etwas worin er sich heimisch machen will und soll – statt ein solches Ganzes hinzustellen, macht sie sich bescheiden zum bloßen Anfang, zur bloßen Gelegenheit anzufangen. Und sie fängt an mit ihrem eigenen bloßen Anfang: mit Sprechraum und Sprechzeit.
Wie denn? Weiter nichts? Ja, weiter nichts. Man habe einmal „Vertrauen“. Man verzichte einmal auf alle Pläne. Man warte einmal ab. Es werden Menschen kommen, Menschen, die eben dadurch, daß sie ins Sprechzimmer der jüdischen Volkshochschule – wer gibt ein besseres Wort?! – kommen, schon bezeugen, daß in ihnen der jüdische Mensch lebendig ist. Denn sonst kämen sie nicht. Man biete einmal zunächst – garnichts. Man höre. Und aus dem Hören werden Worte wachsen. Und die Worte werden zusammenwachsen und werden zu Wünschen. Und Wünsche sind die Boten des Vertrauens. Wünsche, die sich zusammenfinden: Menschen, die sich zusammenfinden: jüdische Menschen – und man versucht, ihnen zu schaffen, was sie verlangen. Ganz bescheiden auch dies. Denn wer weiß, ob solche Wünsche – gewachsene, wirkliche Wünsche, nicht nach irgend einem Schema von Bildung künstlich gezüchtete – ihre Erfüllung finden können . Aber wer es versteht, die Stimme solcher wirklichen Wünsche zu hören, der wird vielleicht dann auch verstehen, ihnen den Weg zu weisen, auf den sie verlangen. Das wird das Schwerste sein. Denn der Lehrer, der solchen gewachsenen Wünschen entgegenkommen kann, darf ja so gar nicht Lehrer nach irgend einem Schema sein; er muß viel mehr sein und viel weniger: ein Meister zugleich und zugleich ein Schüler. Es genügt garnicht, daß er selber „weiß“, noch daß er selber „lehren kann“. Er muß etwas ganz andres „können“: selber – wünschen. Lehrer muß hier sein, wer „wünschen kann“. Im gleichen Sprechzimmer und in der gleichen Sprechstunde, wo sich die Schüler finden, werden auch die Lehrer entdeckt werden. Und es wird vielleicht der Gleiche in der gleichen Sprechstunde als Meister und als Schüler erkannt. Ja eben erst wenn dies geschieht, ist es ganz gewiß, daß er zum Lehrer taugt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zweistromland»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zweistromland» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zweistromland» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.