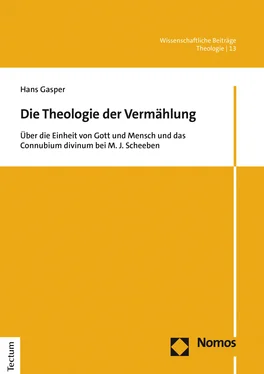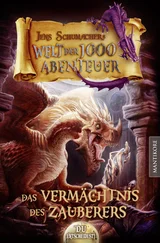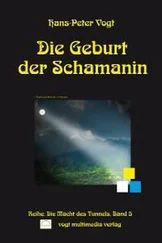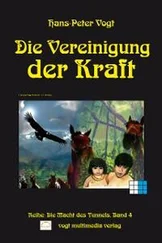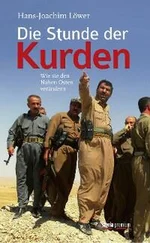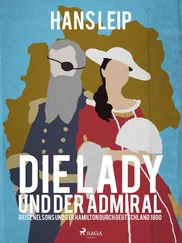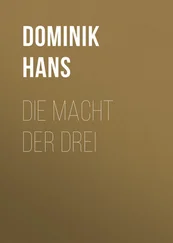Daneben gibt es eine exemplarische Bezogenheit. 424In seiner Stellung als Mikrokosmos ist der Mensch eine Rekapitulation des Makrokosmos, der gesamten Schöpfung, repräsentiert diese in sich und nimmt dabei die Stellung Christi vorweg. 425Alle Bildung und Gestalt ist in der Zeugung des ewigen Bildes Gottes enthalten. Alle geschöpfliche Gestaltung hat ihre Mitte im Menschen als Ebenbild Gottes. Die Christologie setzt dies voraus und führt es zusammen. Der alles fundierende trinitarische Grundprozess, die ewige Zeugung des Sohnes, wird weitergeführt in das Bild Gottes in der geschöpflichen Welt, den Menschen. 426
Nimmt dies die Christologie vorweg, so präludiert eine zweite exemplarische Linie, das Geschlechterverhältnis, dem Connubium divinum. Dessen exemplarische Ewigkeitsgestalt liegt im Leben des dreifaltigen Gottes. Alles, was Scheeben über die eheliche Beziehung von Mann und Frau schreibt, ist als Ganzes so angelegt, dass es der in Christus und im Heiligen Geist vermittelten Gnaden- und Erlösungsordnung entspricht. Das Geschlechterverhältnis ist deshalb zugleich ein Abbild der trinitarischen Konstitution des Sohnes und des Geistes, denn die Gnaden- und Erlösungsordnung ist eine Weiterführung der Trinität in die Menschheit. Das Geschlechterverhältnis steht also in gewisser Hinsicht zwischen Trinität und der in Christus und im Heiligen Geist grundgelegten Gnaden- und Erlösungsordnung, als, um in der Begrifflichkeit Karl Barths zu sprechen, schöpfungsmäßige Voraussetzung des Bundes. 427Um noch einmal den schon zitierten, sehr bezeichnenden Text zur »Typik Adams und seiner Ehe« anzuführen, es sei dabei so gewesen, dass
»die göttliche Idee Christi und seiner Vermählung mit der Kirche wie das Bild eines Originals und Ideals der Bildung Adams und Evas zugrunde lag.« (D V n 1383)
Das Connubium divinum ist diese göttliche Idee. Trinitarisch ausgeweitet heißt das: Der gesamten Anthropologie und der gesamten Christologie in Verbindung mit der Gnadenlehre hat die ewige Zeugung des Sohnes und die Hauchung des Heiligen Geistes wie »das Bild eines Originals und Ideals« zugrunde gelegen.
Aus dieser Skizze erhellt die innere Struktur der Vermählungstheologie. Auf den nexus mysteriorum übertragen heißt das: Die innere Fruchtbarkeit des Lebens Gottes in Zeugung des Sohnes und Hauchung des Heiligen Geistes ist das Urbild. Die »Natur« ist einerseits Abbild, d.h. die Schöpfung mit ihrer Spitze im Menschen und der ehelichen Vereinigung von Mann und Frau. Sie ist zugleich Ort und Vorbild der Mitteilung des trinitarischen Lebens Gottes an die Menschheit in Christus und mit ihm als sein Leib und seine Braut durch den Heiligen Geist. Der franziskanische Ternar bringt dies zum Ausdruck: Kind des Vaters, Braut des Sohnes, Tempel des Heiligen Geistes. In Maria, gottesbräutliche Mutter und gottesmütterliche Braut, findet dies exemplarisch seinen Ausdruck. Deshalb ist Maria das Urbild der Kirche. 428
3.5.5 Der Gebrauch vermählungstheologischer Begriffe und Bilder – Ein Querschnitt
Nach dem, was zuvor grundsätzlich zum Bildergebrauch bei Scheeben gesagt worden ist, nun zur vermählungstheologischen Relevanz der Begriffe und Bilder. Sie sind schon vielfach angeklungen, und sie werden in den einzelnen dogmatischen Traktaten noch einmal begegnen. Erkennbar soll werden, was diese Begriffe und Bilder vermählungstheologisch bedeuten und in welchen Zusammenhängen sie stehen.
3.5.5.1 Fruchtbarkeit
»Fruchtbarkeit« ist der für die Vermählungstheologie, für die Vermählung von Natur und Gnade, grundlegende Begriff und ein grundlegendes Bild, worauf die anderen Begriffe und vor allem Bilder sich beziehen lassen. Das Begriffsbild »Fruchtbarkeit« ist der zentrale Grundbegriff schlechthin. 429Als »Grundbegriff« trägt er die gesamte Theologie Scheebens, inhaltlich wie gnoseologisch. Er bestimmt das Ganze des »nexus mysteriorum«, der »Mysterien des Christentums« und der »Herrlichkeiten der göttliche Gnade«. Deshalb noch einmal aus jenem dazu zentralen Text,
»daß Gott als das absolute Sein zugleich das absolute Gut ist … zugleich die unendlich und überschwenglich fruchtbare und mitteilsame … und in der Fruchtbarkeit ihre eigene höchste Verherrlichung erstrebende Güte … und als solche sich … nach innen … (wie, H.G.) nach außen, betätigt.« (D I n 961)
Die »Konstruktion« der Trinitätslehre aus der »Fruchtbarkeit des göttlichen Lebens« zeigt, wie dieser Grundbegriff auch gnoseologisch das Ganze bestimmt, die Trinitätslehre zunächst, damit das Ganze des nexus mysteriorum. Fruchtbarkeit prägt aber auch die gesamte Gotteslehre, denn in der Dogmatik wird sie als ganze auf den »Überstieg« in die Trinitätslehre durch das Prinzip »Fruchtbarkeit« hin disponiert. 430
Das Begriffsbild »Fruchtbarkeit« bestimmt auch, was Scheeben als »Verklärung der Begriffe« bezeichnet, Transposition natürlich-vernünftiger Erkenntnis ins Übernatürliche durch ein die Vernunft und deren Begriffe »befruchtendes« Prinzip. Dies ist geschieht im »Schoß« des menschlichen Geistes. Der so begründete »intellectus fidei«, das Glaubensverstehen, ist »Empfängnis« und »Geburt« des Gegenstandes der göttlichen Erkenntnis im menschlichen Geist, ist sapientiale »Vereinigung und Verähnlichung« des menschlichen Geistes mit dem göttlichen. Auch hier nimmt Scheeben Bezug auf die Mariologie. Dies wird unten im Kontext von Glaubensanalyse und Glaubensverstehen weiter ausgeführt.
Das Begriffsbild »Fruchtbarkeit« bezeichnet sowohl den aktiven Charakter der göttlichen Lebensmitteilung, der göttlichen »Natur«, die »Zeugung«, wie den empfänglichen Charakter aufseiten des Geschöpfs, die geschöpfliche »Fruchtbarkeit« als eine eigene Aktivität vermittelter Art, die Empfängnis des eingezeugten »Samens«, des »semen divinum«, und dessen »Geburt«, das, was Scheeben in der Mariologie als »mütterliche Zeugung« bezeichnet:
»In mannigfachster Weise weisen die Offenbarung und die Kirchensprache darauf hin, dass die Gnade gegenüber der aus ihr hervorgehenden Lebenstätigkeit der Seele sich verhält wie die väterliche Einwirkung zur mütterlichen Tätigkeit …. « (D VI n 84)
Nach Scheebens Verständnis von »Natur«, »Leben« bzw. »Geist« ist dieses Fruchtbarkeitsgeschehen nichts bloß »Physisches«, sondern zugleich etwas »Moralisches«, ein personal, durch die Liebe bestimmter »Wechselverkehr der Geister und Herzen«. 431Zum »Fruchtbarkeit« kennzeichnenden Grundwort »Schoß« kommt daher das andere Grundwort »Herz« hinzu. Alle einzelnen Geheimnisse des Glaubens sind ein großes Geheimnis als
»die Geheimnisse des Schoßes Gottes und des Herzens Gottes.« (D I n 31)
Mit dem Begriff und dem Bild »Fruchtbarkeit« sind die Phänomene der Offenbarung des Lebens und von dessen Mitteilung verbunden, besonders aus dem Pflanzenreich, »Same«, »Wurzel«, »Trieb«, »Frucht«, »Blüte«, »Spross«, »Blütenduft«. Mit den Pflanzenanalogien schlägt Scheeben wie »Mysterien« und Trinitätslehre zeigen, zugleich eine Brücke zur eucharistischen Theologie, zu »Brot« und »Wein«. 432Pflanzliche Öle führen christologisch zum Bildbegriff der »Salbung«, welche zugleich »Zeugung« und eminente Information ist, pneumatologisch zum Begriffsbild des »Duftes«. 433Der eingezeugte, befruchtende »Same« kann als »Geist« oder »Lebensgeist« verstanden werden. Als geschaffene Gnade oder als Gnadenwirkung ist dann der eingezeugte »Geist« oder »Lebensgeist« bzw. der darin empfangene »Same« »Organ« der »Mütterlichkeit« des Heiligen Geistes. Dadurch werden ungeschaffene und geschaffene Gnade umfasst. 434
3.5.5.2 Schoß – Zeugung
Ihren ersten und grundlegenden Ausdruck findet die Fruchtbarkeit des göttlichen Lebens in der Zeugung des Sohnes im Schoße des Vaters. Die erste Äußerung von »Fruchtbarkeit« ist »Zeugung«, die fundamentale Lebensmitteilung, der »trinitarische Grundprozess«. Entsprechend der trinitarischen Zeugung wird bei der »Zeugung« zunächst vor allem der Aspekt der »Verähnlichung« betont. Der klassische Belegtext ist: »generatio est origo viventis de vivente coniuncto in similitudinem naturae«.
Читать дальше