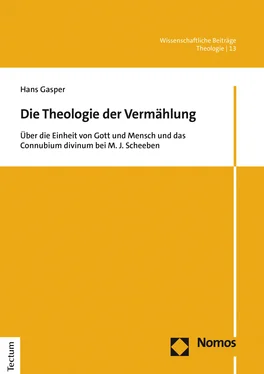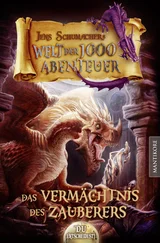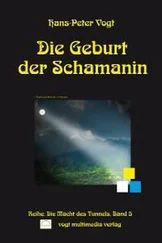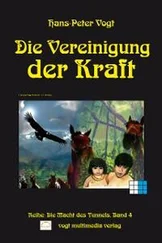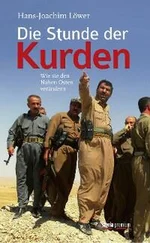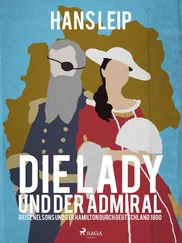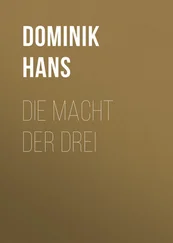»Für den Glauben ist Gott Trinität, sich ergießende innere Fruchtbarkeit, die sich in der hypostatischen Union Christi in die dazu vorbereitete Schöpfung ergießt, welche wiederum – durch die Gnade und für die Gnade Christi zubereitet – ihre Spitze in der bräutlichen Mutterschaft Mariens besitzt …« 405
Es behandele diese »Eroslehre« bzw. Vermählungstheologie die
»drei Aspekte des einen Conubiums (sic!, H.G.): Gott – Menschheit, zwei Naturen in Christus, Christus – Maria, aus welchem sich schlechthin alle weiteren Aspekte der Kirche-, Erlösungs-, Rechtfertigungs- und Gnadenlehre ergeben«. 406
Balthasar benennt hier die Dimensionen. Die »Eroslehre« oder Vermählungstheologie erstreckt sich auf die Trinität, die Anthropologie, die Gnadenlehre, die Mariologie, die Ekklesiologie und Sakramententheologie (bei den beiden letzteren gilt dies vor allem für die »Mysterien«, da die Dogmatik unvollendet blieb). In der Christologie dominieren informationsanaloge, um die Seele-Leib-Einheit zentrierte Begriffe und Bilder. Da diese Begriffe und Bilder aber dem Begriff der Zeugung subsumiert sind, welcher wiederum der Fruchtbarkeit verbunden ist, ist auch die ganze Christologie als integrales Stück der Vermählungstheologie zu sehen. Zudem wird auch die Verbindung der Naturen in Christus als Vermählung dargestellt, aber gewissermaßen sekundär. Christus ist aber der Terminus der bräutlichen Vermählung, was besonders für die Mariologie – hier ist der ursprüngliche Ort des Connubium divinum – wie die Ekklesiologie gilt, die deshalb der Christologie und zugleich der Pneumatologie eng verbunden sind. Die Vermählungstheologie bezieht sich schließlich inhaltlich aufs Ganze von Scheebens Theologie, aber auch im begrifflichen und bildlichen Material.
Auf diese Felder lässt sich die Vermählungstheologie bzw. »Eroslehre« konzentrieren:
1. Die »Vermählung von Natur und Gnade«.
2. Die Zuordnung von Anthropologie und »Mysterien des Christentums«.
3. Das »Connubium divinum« im engeren Sinn, also in christologisch-mariologischer Konkretion.
4. Der Gebrauch vermählungstheologischer Begriffe und Bilder.
Dies wird folgend nur überblickshaft in seiner Struktur gezeigt, um dann im Kontext der einzelnen Traktate der Theologie ausführlich behandelt zu werden.
3.5.2 Die »Vermählung von Natur und Gnade«
Die »Vermählung von Natur und Gnade« mit dem Resultat der »Übernatur« bzw. der »Gesamtnatur höherer Ordnung« ist die innere Fluchtlinie der gesamten Vermählungstheologie. Diese »Vermählung« hat zunächst in Scheebens Theologie eine engere Bedeutung, die Genese und Vollendung der Verbindung von Natur und Gnade (motio ad gratiam, Rechtfertigung). Scheeben handelt davon zum ersten Mal im Schlusskapitel seines Erstlings von 1861, von »Natur und Gnade« und zwar unter dem Titel: »Verbindung und Vermählung von Natur und Gnade (Übernatur)«. Er bezeichnet dort die »Vermählung von Natur und Gnade« als das »lichtvolle Geheimnis der christlichen Heilsökonomie und somit der ganzen höheren Weltordnung.« (NG 181)
Mehrere Faktoren wirken bei dieser Vermählung zusammen: Es ist eine Bewegung der Natur, die in der Wurzel zugleich getragen und bestimmt ist durch eine übernatürliche Erhebung; es ist eine freie, moralische Bewegung und zugleich, da aus der übernatürlich erhobenen Natur hervorgehend, etwas Physisches, eine Bewegung also mit physisch-moralischem Doppelcharakter. 407Diese Bewegung kommt zum Abschluss in der Eingießung der heiligmachenden Gnade. Da diese zugleich in »wechselseitiger Priorität«, »per modum unius«, mit der Mitteilung der übernatürlichen Liebe verbunden ist, trägt nicht nur der Prozess, sondern auch der Abschluss einen physisch-moralischem Doppelcharakter. Das Ganze ist deshalb als übernatürliche Erhebung der Natur, als erhebend verklärende Neubestimmung der Natur, zugleich Mitteilung einer neuen Form, Information, und als Mitteilung neuen Lebens Zeugung. Als wechselseitige Beziehung der Liebe und zugleich als Konstitution eines quasi-physischen »organischen Ganzen« ist dies zugleich Vermählung. Das Modell »wechselseitiger Priorität« von Prozess und Abschluss, von Physischem und Moralischem ist ein »organisches« und »harmonisches« Ineinanderwirken verschiedener Prinzipien, fügt sich so zur Figur des »organischen Ganzen« im Prozess und als »Übernatur« oder »Gesamtnatur höherer Ordnung« im Resultat.
Es handelt sich also um das Ineinander von göttlicher Mitteilung der Gnade – rechtfertigende, heiligmachende Gnade, geschaffene und ungeschaffene Gnade – und menschlicher Aufnahme und Empfängnis dieser Gnade als Erhebung und Verklärung der Natur (physisch) und als Verbindung wechselseitiger Liebe (moralisch). Das Ganze wird von Scheeben mit Begriffen von ehelicher Verbindung und der Lebensmitteilung und Lebensäußerung beschrieben, um nur diese zu nennen: Fruchtbarkeit, Zeugung, Vermählung, Schoß, Same, Empfängnis, Frucht, Geburt.
Scheeben vergleicht die gehorsame Annahme der Gnade mit dem »Fiat der heiligen Jungfrau bei der Empfängnis des ewigen Wortes.« (D III n 961) Die Mariologie bzw. die Empfängnis und Geburt des Gottessohnes in Maria und durch Maria ist das Paradigma der Gnadentheologie und der Vermählungstheologie. Die gesamte Darstellung der Konstitution Christi und der Konstitution Marias zur Gottesmutter ist parallel zu Mitteilung und Empfang der göttlichen Gnade gestaltet. 408Dazu quasi programmatisch:
»Die ganze Art und Weise, wie sich die göttliche Natur in der Person des Wortes mit der menschlichen im Schoße der jungfräulichen Mutter vermählte, entspricht in allen Momenten (H.G.) der Art und Weise, wie sich Gott in der Gnade mit der Natur in jedem Menschen vermählen will.« (NG 195) 409
Es geschieht, dass die Natur bzw. die Seele
»durch die Gnade und in ihr jene himmlische Fruchtbarkeit empfange (kursiv, H.G.) und so das eigene Bild des göttlichen Lichtes und die Frucht (kursiv, H.G.) des göttlichen Lebens erzeuge (kursiv, H.G.) ja den Sohn Gottes selbst gewissermaßen in sich wiedergebäre.« (NG 195)
Scheeben präzisiert das »gewissermaßen«. Es handele sich nicht um eine »physische« Einheit sondern es werde der Sohn »in moralischer Einheit der Person, durch ein reelles Bild seines göttlichen Lichtes und eine reelle Partizipation seines göttlichen Lebens in uns wiedergeboren.« (ebd.) Hier merkt man Scheebens zur Zeit von »Natur und Gnade« noch restriktive Position hinsichtlich nichtappropriierter Beziehungen zu der göttlichen Personen.
Deutlicher heißt es in den »Herrlichkeiten«:
»Denn durch die Gnade werden wir wahrhaft in wunderbarer Weise der Mutter Gottes ähnlich … selbst ihre Mutterschaft ahmen wir in uns bei dem Empfange der Gnade nach. Derselbe Heilige Geist, der in den Schoß Mariä herabstieg, um ihm eine himmlische Fruchtbarkeit zu verleihen, steigt auch in unsere Seele herab, um den Sohn Gottes in ihr geistigerweise zu zeugen. Wie Maria dadurch, daß sie dem Worte des Engels Gehör gab und den Willen des himmlischen Vaters erfüllte, Mutter des Sohnes Gottes zugleich dem Fleische und dem Geiste nach wurde so soll auch unsere Seele, indem sie das Wort Gottes gläubig annimmt und dem Willen des himmlischen Vaters, der ihr seine Gnade schenken will, gehorsam nachkommt, den Sohn Gottes dem Geiste nach in sich wiedergebären.« (H 52)
Dieser Abschnitt hat insofern ein besonderes Gewicht, als er unverändert in allen von Scheeben selbst herausgegeben Auflagen blieb. Er erhielt durch Scheebens gewandelte Auffassung hinsichtlich nichtappropriierter Beziehungen zu den göttlichen Personen zusätzliches Gewicht (spätestens mit den »Mysterien« 1865). 410Der Herausgeber der nach Scheebens Tod erschienenen Auflagen, Albert. M. Weiss OP (1844–1925), hat anfangs Scheebens Text durch eine Umstellung abgeschwächt, später dann erheblich umformuliert. 411Umgekehrt unterstreicht gerade Scheebens pointierte Formulierung seine Intention, Marias Empfängnis und Geburt Christi mit der Gnadenunion zu parallelisieren. 412
Читать дальше