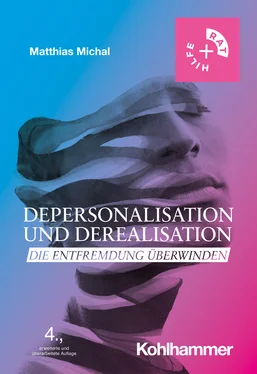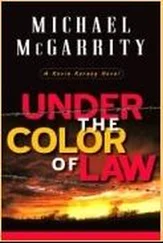Die Panikstörung ist durch einen heftigen Angstanfall gekennzeichnet, der für die Betroffenen wie aus heiterem Himmel kommend auftritt. Der Angstanfall dauert meist zwischen 5–30 Minuten. Während des Anfalls treten meist mehrere der oben genannten Angstsymptome auf. Sehr häufig entwickelt sich dann eine sogenannte Erwartungsangst, das heißt, die Betroffenen kommen nach einem Angstanfall nicht mehr richtig zur Ruhe, sondern erwarten ängstlich angespannt den nächsten Angstanfall. Panikattacken sind häufig Auslöser einer DDS. Sehr häufig berichten Betroffene aber, dass die Häufigkeit und Schwere der Panikattacken mit zunehmender Schwere und Dauerhaftigkeit der Depersonalisation nachgelassen hat. Nicht selten entwickelt sich aus Panikattacken heraus eine sogenannte Agoraphobie.
Bei der Agoraphobie vermeiden die Betroffenen bestimmte Orte (z. B. Kaufhäuser, Supermärkte, Menschenmassen) und Situationen (z. B. allein zu reisen, allein das Haus zu verlassen) aus der Angst heraus, dort in eine hilflose Lage zu geraten beziehungsweise eine Panikattacke zu bekommen. Obwohl den Betroffenen klar ist, dass ihre Reaktionen übertrieben und unvernünftig sind, kann diese Angst so übermächtig werden, dass sie sich nicht mehr trauen, ohne eine Begleitperson das Haus zu verlassen. Durch das Vermeiden der betreffenden Situationen können Patienten mit einer Agoraphobie vorübergehend relativ angstfrei werden. Allerdings schränkt sich durch das Vermeidungsverhalten ihr Spielraum immer weiter ein, was letztendlich zu einer Verschlimmerung führt.
Unter einer generalisierten Angststörung wird eine Angsterkrankung verstanden, die von ständigen übertriebenen Sorgen und daraus folgender Anspannung, innerer Unruhe, Angst und Nervosität geprägt ist. Die Betroffenen nehmen immer gleich das Schlimmste an, z. B. hinsichtlich ihres Berufes oder der Sicherheit der Familie, und befinden sich deshalb in einem dauerhaft erhöhten Alarm bzw. Angstzustand. Alle oben genannten Angstsymptome können dabei auftreten. Besonders häufig sind aber eine ständige Nervosität, Schreckhaftigkeit, Gereiztheit und Einschlafstörung.
Besonders häufig bei Patienten mit einer DDS sind soziale Ängste und die Angsterkrankung »Soziale Phobie« (Michal et al. 2005b, 2006a). Die zentrale Angst bei der sozialen Phobie ist die Furcht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und sich lächerlich zu benehmen beziehungsweise in eine beschämende Situation zu geraten. Typische angstbesetzte Situationen sind z. B. ein Referat zu halten, vor anderen zu sprechen, in der Öffentlichkeit zu essen oder bei Leistungssituationen beobachtet zu werden. Die Betroffenen haben z. B. in der Kantine Angst, man könnte bemerken, wie sie zittern, wenn sie ihre Hand nach dem Glas ausstrecken, oder sie könnten rot werden oder sich sonst irgendwie peinlich benehmen und so den Spott und die Verachtung der anderen auf sich ziehen. Bei leichteren Formen sind oft nur besondere Situationen angstbesetzt (z. B. eine Rede zu halten), bei schweren Formen tritt die Angst in nahezu allen sozialen Situationen auf. Wie die DDS so beginnt auch die soziale Phobie eher früh im Leben, meist vor dem 25. Lebensjahr.
Zwangsstörungen sind durch Gedanken, Vorstellungen und Handlungen gekennzeichnet, die sich den Betroffenen immer wieder aufzwingen, obwohl sie von den Betroffenen für unsinnig gehalten werden und sie sich auch dagegen zu wehren versuchen. Typische Zwangshandlungen sind Waschzwänge, Wiederholungszwänge oder Kontrollzwänge. Bei Letzteren muss der Betroffene zum Beispiel immer wieder, oft über viele Minuten, kontrollieren, ob die Wohnungstür auch wirklich verschlossen ist. Bei Zwangsgedanken drängen sich den Patienten in quälender Weise immer wieder aggressive, gewalttätige oder obszöne Vorstellungen auf, die als abstoßend und persönlichkeitsfremd erlebt werden. Beispiele sind die Vorstellung, von einer Brücke zu springen, obwohl keine Suizidgedanken vorliegen, jemanden zu schlagen oder obszöne Handlungen zu begehen. Diese Zwangsgedanken versetzten die Betroffenen in große Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren und die Vorstellung in die Tat umzusetzen. Dies kommt praktisch aber niemals vor. Wenn bei Patienten mit Zwangsgedanken auch noch zusätzlich schwere Depersonalisation auftritt, so verschlimmert dies meiner Erfahrung nach ganz massiv die Ängste der Patienten vor einem Kontrollverlust. Für die Diagnose einer Zwangsstörung müssen diese belastenden Handlungs- oder Gedankenzwänge über mindestens zwei Wochen regelmäßig vorkommen.
Die Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Erkrankung, die in Folge eines traumatischen Ereignisses, dessen Opfer oder Zeuge man wurde, auftreten kann. Beispiele für traumatische Ereignisse sind Gewalttaten, Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch, Geiselnahmen, Unfälle, Katastrophen, aber auch die Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Beispielsweise erkranken bis zu 10 % aller Opfer eines Herzinfarktes oder eines schweren Verkehrsunfalls an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Die Posttraumatische Belastungsstörung tritt in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach einem traumatischen Ereignis auf. Das Beschwerdebild ist dadurch gekennzeichnet, dass sich immer wieder belastende Erinnerungen, Bilder und Gedanken an das Trauma aufdrängen, Alpträume auftreten, oder es aber zu Erinnerungslücken kommt und man sich nicht mehr richtig an das belastende Ereignis erinnern kann. Weiterhin kann es bei diesen Patienten zu einer nervlichen Übererregung kommen, die sich in Form von Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen und Reizbarkeit bis hin zu Wutausbrüchen zeigt. Sehr häufig ist auch die Entwicklung eines ausgeprägten Vermeidungsverhaltens. Die Betroffenen versuchen jede Situation zu vermeiden, die an das Trauma erinnern könnte. Oder es entwickelt sich eine allgemeine emotionale Taubheit, die durch sozialen Rückzug, Interesseverlust, innere Teilnahmslosigkeit und oft auch Depersonalisation und Derealisation gekennzeichnet ist (vgl. auch LL Posttraumatische Belastungsstörung). Etwa ein Drittel der Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung erleben in Reaktion auf das traumatische Ereignis anhaltende DP-DR. Im DSM-5 wird dies als der dissoziative Subtyp der PTBS bezeichnet. DDS-Patienten leiden eher selten an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (Simeon et al. 2003b). Umgekehrt sind jedoch bei schwer traumatisierten Menschen Depersonalisation, Derealisation und andere dissoziative Symptome (z. B. Amnesie) häufig.
2.2.3 Somatoforme Störungen
Unter der Gruppe der somatoformen Störungen werden seelische Erkrankungen verstanden, die sich vor allem in körperlichen Beschwerden äußern. Dabei kann das Ausmaß der Beschwerden und die damit einhergehende Belastung nicht durch körperliche Befunde erklärt werden. Eine andere Umschreibung für somatoforme Störungen ist deshalb auch »organisch nicht hinreichend erklärbare Beschwerden« oder »funktionelle Störungen«. Trotz mehrfacher ärztlicher Abklärung haben die Betroffenen Schwierigkeiten, eine seelische Ursache für ihre Beschwerden anzuerkennen. Die häufigsten somatoformen Krankheiten sind chronische Schmerzen, Schwindelgefühle und Magen-Darm-Beschwerden (»Reizdarm«, »Reizmagen«).
2.2.4 Persönlichkeitsstörungen
Das Wort Persönlichkeitsstörung hört sich für Laien meist schrecklich an. Aber auch viele meiner Kollegen haben aus den gleichen Gründen Probleme mit dieser Diagnose. Sie scheuen dann davor zurück, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung zu vergeben oder Patienten über die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung aufzuklären. Das Wort Persönlichkeitsstörung kann – zu Unrecht – das demoralisierende Gefühl auslösen, bis in den Grund der Persönlichkeit »gestört« oder »kaputt« zu sein. Eigentlich steht der Begriff der Persönlichkeitsstörung aber für eine seelische Krankheit, die sich durch bestimmte, über mehrere Jahre bestehende Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster auszeichnet, unter denen der Betroffene leidet und die zu einer Beeinträchtigung im sozialen, beruflichen und zwischenmenschlichen Leben führt. Diese »Krankheit« ist nicht angeboren, sondern letztendlich das Ergebnis einer Anpassung des Individuums an seine frühen – meist sehr belastenden – Entwicklungsbedingungen. Auch wenn das angeborene Temperament, wie z. B. Sensibilität und Angstbereitschaft, für die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung eine Rolle spielt, sind aber die Umweltbedingungen entscheidend. Das heißt mit anderen Worten, dass die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nicht die Natur oder das innere Wesen einer Person beschreibt, sondern etwas, das sich über die eigentliche Person darübergelegt hat. Manche Psychotherapeuten nennen dies auch ein »falsches Selbst« oder »Charakterpanzer«. Beispielsweise sind viele Persönlichkeitsstörungen durch chronische Minderwertigkeitsgefühle gekennzeichnet. Sich minderwertig zu fühlen, ist aber nicht das Wesen des Menschen, sondern eine Reaktion auf langanhaltende Erfahrungen, die den eigenen Selbstwert beschädigt haben oder besser gesagt, Mechanismen in Gang gesetzt haben, die ständig das eigene Selbstwertgefühl angreifen. Diese Minderwertigkeitsgefühle lassen sich aber durch die Bearbeitung der krankmachenden Mechanismen und neue Beziehungserfahrungen auflösen.
Читать дальше