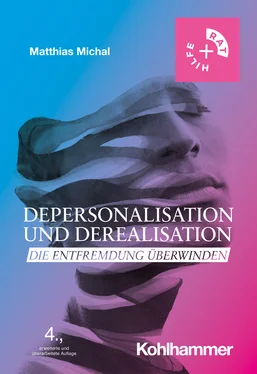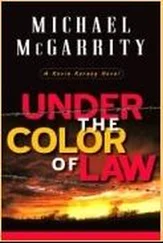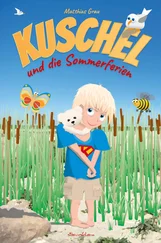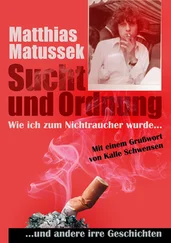Soweit dieser fast 150 Jahre alte Bericht, in dem sich über weite Passagen auch noch heute Patienten mit einer DDS wiedererkennen werden.
Für dieses Gefühl der Unwirklichkeit und Abgelöstheit wurde zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von dem französischen Psychiater Ludovic Dugas »Depersonalisation« als medizinischer Fachbegriff eingeführt (Dugas 1898). Dugas selbst entlehnte den Begriff der Depersonalisation den Tagebüchern des französisch-schweizerischen Schriftstellers und Philosophieprofessors Henri Frédéric Amiel (1882–1881). Amiel schrieb wie ein Besessener Tagebuch, 17.000 Seiten wurden nach seinem Tod gefunden. In der Übersetzung von Paul Schilder lautet eine seiner Selbstbeschreibungen so:
»Ich höre mein Herz schlagen, und mein Leben zieht vorüber. Es scheint mir, dass ich eine Statue geworden bin, an den Ufern des Flusses der Zeit […]. Ich fühle mich namenlos, unpersönlich, mein Blick ist starr, wie der eines Toten, mein Geist ist unbestimmt und auf alles gerichtet, auf das Nichts oder das Absolute; ich bin aufgehoben, es ist, wie wenn ich nicht wäre. Dieser Zustand ist weder Betrachtung noch Erstarrung, er ist weder schmerzhaft, noch freudig noch traurig; er ist außerhalb jedes besonderen Gefühls und jedes begrenzten Gedankens. […] Ich habe die Wesenlosigkeit eines Fluidums, eines Dampfes, einer Wolke und alles wandelt sich leicht in mir« (Schilder 1914, S. 156).
Letztendlich wurde die Depersonalisations-Derealisationsstörung bereits Ende des 19. Jahrhunderts definiert. Bis heute hat sich daran nichts mehr Entscheidendes geändert wie die englische Forschergruppe um Mauricio Sierra zeigen konnte (Sierra und Berrios 2001), indem sie 200 Fälle mit einer DDS, die seit 1898 bis in unsere Zeit in der medizinischen Literatur veröffentlicht wurden, miteinander verglichen. Seit 1898 hatte sich die klinische Beschreibung der DDS im Kern nicht geändert. Immer wieder fanden sich die drei Symptombereiche, emotionale Abgelöstheit, Derealisation und verändertes Körpererleben.
Im Folgenden wird noch auf zwei andere Krankheitsbegriffe eingegangen, die zwar heute im klinischen Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden, die jedoch sehr gut zwei Patientengruppen mit einer DDS beschreiben; nämlich die Entfremdungsdepression und das phobische Angst-Depersonalisationssyndrom.
3.1 Die Entfremdungsdepression
Der Mainzer Psychiater Nikolaus Petrilowitsch (1924–1970) beschrieb zuletzt die sogenannte Entfremdungsdepression als eine Sonderform einer Depression. Bei der Entfremdungsdepression klagen die Betroffenen gleichzeitig über depressive Beschwerden und ausgeprägte Depersonalisation. Neben der depressiven Niedergeschlagenheit leiden die Betroffenen vor allem unter dem »Gefühl der Gefühllosigkeit«. Diese Gefühllosigkeit spüren die Patienten als eine Art von Hemmung oder Blockade im Bereich der Stirn oder des Magens; es sei so, als ob nichts mehr richtig zu ihnen hindurch dringe (Petrilowitsch 1956). Das entscheidende Kennzeichen der Entfremdungsdepression ist der von außen beobachtbare Widerspruch zwischen den Klagen der Betroffenen über ihre Niedergeschlagenheit, Leblosigkeit, Konzentrationsstörungen und Verzweiflung einerseits, sowie ihr auf den Arzt und das Umfeld nahezu normal wirkendes Erscheinungsbild andererseits (Petrilowitsch 1956). Die Patienten bewegen sich nicht verlangsamt, ihre Mimik und Gestik sind lebendig und spiegeln lebhafte Gefühle wider. Im Gespräch mit Ihnen fallen keine Denkhemmungen auf. Typische Klagen der Betroffenen sind außerdem ein verändertes Körperempfinden wie z. B. über eine »schwebende Leichtigkeit des Körpers« oder das Gefühl, der Kopf schwebe über dem Körper so, als ob der Kopf die Verbindung zum Körper verloren hätte (vgl. Petrilowitsch 1956, S. 266). Dies führt bei den Patienten dann oft zu Ängsten, sie könnten an einer schweren körperlichen Erkrankung, zum Beispiel einen Hirntumor leiden. Sehr häufig sind auch Klagen darüber, dass der Kopf wie leer sei, dass alles wie mechanisch ablaufe und Betroffene sich erleben, als ob sie nur noch wie ein Automat funktionierten. Außerdem finden sich fast immer Klagen über einen Einbruch des geistigen und körperlichen Leistungsvermögens, Konzentrationseinbußen und rasche Erschöpfbarkeit. Das Gefühl der Gefühllosigkeit wird besonders quälend gegenüber nahestehenden Angehörigen empfunden. Petrilowitsch zitiert hier einen Kranken, der am Tiefpunkt seiner Verzweiflung erklärte: »Ich kann den Menschen nicht mehr lieben, den ich liebe« (Petrilowitsch 1956, S. 273).
3.2 Das Phobische-Angst-Depersonalisationssyndrom
In einer 1959 erschienenen Arbeit beschrieb der britische Psychiater Sir Martin Roth (1917–2006) ein seiner Erfahrung nach häufiges Krankheitsbild, das durch ausgeprägte Depersonalisation und Ängste gekennzeichnet ist (Roth 1959/1960). Das Krankheitsbild trat in der Regel plötzlich auf. Als Auslöser fand sich meist der Verlust oder drohende Verlust einer nahestehenden Person, von der der Betroffene sehr abhängig war, oder eine eigene körperliche Erkrankung. Ein typischer Fall für ein Phobisches-Angst-Depersonalisationssyndrom sei nachfolgend wie von Roth geschildert wiedergegeben:
»Eine intelligente, skrupulöse, sehr sorgfältige und gewissenhafte Frau von 32 Jahren war extrem abhängig von ihrer recht herrschsüchtigen Mutter, für die sie trotzdem unklare Gefühle hegte. Sie hatte mit ihrem Mann einige Jahre in der Wohnung ihrer Mutter gelebt. Eines Tages kam ihr Mann von der Arbeit zurück und teilte ihr vorsichtig mit, dass ihre Mutter heute auf der Straße tot hingefallen sei. In ihrer Panik lief sie aus dem Haus und über die Straße zu ihrer Schwiegermutter und weigerte sich, jemals wieder die Wohnung ihrer Mutter zu betreten. Starke Entfremdungsgefühle setzten fast unmittelbar ein sowie die Angst, allein zu sein oder das Haus zu verlassen, anfangs auch dann, wenn sie Begleitung hatte, später nur, wenn sie allein war«. Die Depersonalisation war gekennzeichnet durch: »Das Gefühl von sich selbst losgelöst zu sein, sich wie eine Marionette zu bewegen, die eigene Stimme aus der Ferne zu hören, und der traumähnliche Aspekt, den die äußeren Vorgänge annahmen«. Eine Intensivierung ihrer Ängste trat unter folgenden Umständen auf: »Auf der Straße überkamen sie Schwindelgefühle, sie spürte Leere im Kopf und Unsicherheiten in den Beinen, und sie fühlte sich schwanken, wenn Menschen oder Flugzeuge sie passierten. In dichtgedrängten Straßen. Läden oder Fahrzeugen war sie besonders gespannt und ängstlich, und die Furcht vor dem Tod oder dem Verlust des Bewusstseins steigerte sich. Eine Komponente dieser Angst war die drohende Möglichkeit, die allgemeine Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu lenken, dass sie das Bewusstsein verlor, eine Szene machte oder zusammenbrach und in einem hilflosen Zustand von einer Zuschauermenge betrachtet würde« (zitiert nach Roth 1959, S. 356).
Heute würde man dieser Patientin die Diagnosen einer »Agoraphobie mit Panikstörung« und vermutlich eines Depersonalisations-Derealisationssyndroms geben, wenn das Gefühl von sich selbst losgelöst zu sein und der traumähnliche Bewusstseinszustand kontinuierlich und nicht nur im Rahmen von Panikattacken auftreten.
7Pollution bedeutet unwillkürlicher Samenerguss ausgelöst durch einen Orgasmus, der während des Schlafes ohne aktives Zutun und ohne Wachbewusstsein bei Männern ab der Pubertät auftreten kann. In der damaligen Zeit wurde dies als moralisch verwerflich und ungesund angesehen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше