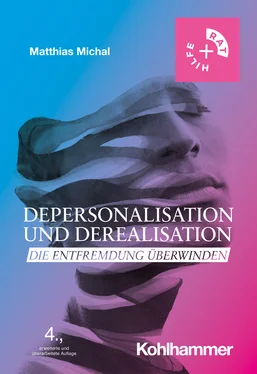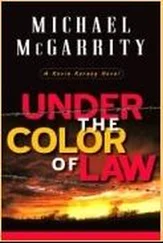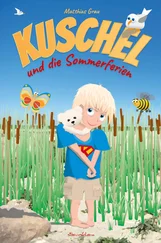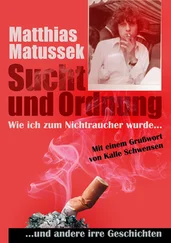Die richtige Einordnung der eigenen Krankheitssymptome ist für die Kommunikation mit Ärzten und Psychotherapeuten hilfreich. Dies erleichtert es dem Patienten, den Behandlern deutlich zu machen, dass nicht alle Beschwerden in der Diagnose einer Depression oder Angststörung aufgehen. Mit dem entsprechenden Wissen fällt es dem Patienten leichter, sich zu äußern, wenn man den Eindruck hat, vom Fachmann falsch verstanden zu werden. Es ist aber auch für einen Patienten aufschlussreich zu erfahren, dass nicht alle seine Probleme zur Depersonalisations-Derealisationsstörung gehören. Er erkennt beispielsweise, dass er möglicherweise bereits vor dem dramatischen Beginn der Depersonalisations-Derealisationsstörung gesundheitliche beziehungsweise seelische Probleme hatte; oder aber er merkt, dass eine Verschlechterung seines Befindens eher mit einer Depression und nicht unbedingt mit einer Verschlimmerung der Depersonalisation zusammenhängt. Eine Patientin lernte zum Beispiel im Verlauf ihrer Behandlung, ihre unterschiedlichen Reaktionen auf Stress besser zu unterscheiden. So hatte sie schmerzhafte Verspannungszustände im Gesichts- und Kopfbereich früher als identisch mit ihrer Depersonalisation interpretiert, weil Verspannungszustände und eine Verschlimmerung der Depersonalisation meist gleichzeitig auftraten. Im Verlauf ihrer Therapie kam es jedoch bereits nach etwa 20 Sitzungen zu einem deutlichen Rückgang der Depersonalisation. Dabei bemerkte sie, dass diese Verspannungszustände im Gesichtsbereich eigentlich unabhängig von der Depersonalisation sind und ihr als psychosomatisches Symptom eine persönliche Überlastung anzeigen. Bewusst eingesetzte Entspannung und physiotherapeutische Übungen konnten hier dann weitere Linderung bringen.
2.2.1 Depressive Störungen
Depressive Störungen sind die nach den Angsterkrankungen häufigsten seelischen Erkrankungen. Nachfolgend referiere ich die wichtigsten Fakten zu depressiven Erkrankungen auf Grundlage der Leitlinie (LL) »Unipolare Depression« (LL, Unipolare Depression).
In der erwachsenen Bevölkerung leiden während eines Jahres mindestens 7,7 % an einer Depression. Auf die Lebenszeit bezogen erleiden mindestens 17 von 100 Personen einmal eine Depression. Davon erkrankt etwa die Hälfte bereits vor ihrem 31. Lebensjahr. Eine Depression kann aber auch erstmalig bereits in der Jugend auftreten.
Depressionen werden anhand nachfolgender Symptome diagnostiziert. Man unterscheidet hierbei Haupt- von Nebensymptomen. Die Symptome müssen über eine Dauer von zwei Wochen an der Mehrzahl der Tage zu einer deutlichen Belastung führen. Die Hauptsymptome einer depressiven Erkrankung sind (1) die gedrückte, niedergeschlagene Stimmung; (2) der Interessenverlust und die Freudlosigkeit und (3) die gesteigerte Ermüdbarkeit und der Antriebsmangel (z. B. dass man sich ständig müde und erschöpft fühlt und nur unter Schwierigkeiten die Aufgaben des Alltags bewerkstelligen kann). Für die Diagnose einer Depression müssen mindestens zwei dieser Hauptsymptome und zwei oder mehr Zusatzsymptome vorliegen. Die Zusatzsymptome einer Depression sind a) Konzentrationsschwierigkeiten (zeigen sich beispielsweise darin, dass man Mühe hat, Texte zu lesen, einem Gespräch zu folgen oder fernzusehen; b) Versagensgefühle (d. h. man fühlt sich selbstunsicher, traut sich nichts mehr zu oder kommt sich minderwertig vor); c) Schuldgefühle (d. h. man macht sich ständig Selbstvorwürfe); d) eine negative und pessimistische Einstellung gegenüber der Zukunft; e) Todeswünsche, Lebensüberdruss und Suizidgedanken; f) Schlafstörung in Form von Ein- und Durchschlafstörungen mit der Folge eines nicht erholsamen Schlafes oder eine deutliche Ausdehnung der Schlafdauer; und g) Appetitstörungen (verminderter oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung).
Häufig kommen bei einer Depression auch zahlreiche körperliche Beschwerden vor. Typisch sind Abgeschlagenheit, Mattigkeit, Magendruck, Verstopfung, Durchfall, diffuser Kopfschmerz, Druckgefühl in Hals und Brust, Herzbeschwerden, Atembeklemmung, Schwindelgefühle, Flimmern vor den Augen, Muskelverspannungen, Verlust des sexuellen Verlangens, Sistieren der Menstruation, Impotenz und andere sexuelle Funktionsstörungen.
Anhand der Anzahl und Ausprägung der Haupt- und Nebensymptome unterscheidet man leicht-, mittel- und schwergradige Depressionen. Eine leichtgradige Depression ist durch zwei Hauptsymptome und zwei Zusatzsymptome gekennzeichnet, eine schwergradige Depression durch drei Hauptsymptome und mindestens vier Zusatzsymptome. Meistens verlaufen Depressionen episodisch. Die Dauer einer Episode beträgt meist zwischen vier bis acht Monate. Bei einem Teil der Patienten dauert eine Depression jedoch über zwei Jahre an.
Als Dysthymie wird eine länger als zwei Jahre bestehende depressive Verstimmung bezeichnet. Maßgeblich für die Diagnose einer Dysthymie ist, dass der Betroffene sich mehr als die Hälfte aller Tage in den letzten zwei Jahren depressiv gefühlt hat, zumindest zeitweise und unter einigen der folgenden Symptome litt: Energielosigkeit, unruhiger Schlaf, schlechter Appetit, und geringes Selbstbewusstsein.
Mehr als die Hälfte der Patienten, die einmal an einer Depression litten, werden im Lauf ihres Lebens wieder an einer Depression erkranken. Das Risiko für eine Wiedererkrankung erhöht sich mit der Zahl der Krankheitsepisoden.
Für depressive Erkrankungen gibt es in der Regel mehrere Ursachen. Zum einen werden genetische Ursachen angenommen. Depressive Störungen kommen familiär gehäuft vor. Angehörige ersten Grades haben ein etwa 50 % höheres Risiko als Menschen aus der Allgemeinbevölkerung. Biografische Risikofaktoren für die spätere Erkrankung sind Verlusterlebnisse in der Kindheit, die sich bei depressiven Patienten zwei bis drei Mal so häufig in der frühen Biografie finden. Aktuelle Belastungsfaktoren, die zur Erkrankung beitragen, sind chronischer Stress am Arbeitsplatz, kritische Lebensereignisse, schwere körperliche Erkrankungen, Armut und mangelnde soziale Unterstützung.
Die Behandlung einer Depression besteht aus Psychotherapie und/oder Psychopharmakotherapie. An späterer Stelle werde ich darauf noch detaillierter eingehen.
Die diagnostische Entscheidung, ob Symptome von Depersonalisation und Derealisation in einer depressiven Episode aufgehen, oder ob die Diagnose eines Depersonalisation-Derealisationssyndroms sinnvoll ist, fällt nicht immer leicht. Denn das Gefühl der Gefühllosigkeit ist auch bei depressiven Episoden nicht selten. Beim Depersonalisation-Derealisationssyndrom finden sich jedoch noch weitere Symptome von Depersonalisation und Derealisation und diese Symptome stellen die Hauptklage des Patienten dar. Des Weiteren ist die zeitliche Abgrenzung für die diagnostische Entscheidung hilfreich. Wenn die Depersonalisation/Derealisation dem Beginn einer depressiven Episode eindeutig vorangeht oder nach dem Ende einer depressiven Episode eindeutig weiterbesteht, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass ein Depersonalisations-Derealisationssyndrom vorliegt (vgl. DSM-5, APA 2013, S. 305 ff).
2.2.2 Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Zwänge
Etwa die Hälfte aller Menschen, die einmal unter einer Depression litten, erkrankt auch an einer Angststörung. Angststörungen sind die häufigsten seelischen Erkrankungen. In der Allgemeinbevölkerung beträgt die Krankheitshäufigkeit über 12 Monate etwa 15 %, die 4-Wochenprävalenz 9 % (Wittchen und Jakobi 2004).
Nachfolgend wird auf die häufigsten Angststörungen sowie die oft dazu gezählten Erkrankungen Posttraumatische Belastungsstörung und Zwangsstörung eingegangen.
Die Fähigkeit, Angst zu erleben, ist für uns Menschen überlebenswichtig. Ängste helfen uns, Gefahren zu erkennen und entsprechend zu handeln. Von pathologischen Ängsten und Angsterkrankungen sprechen wir, wenn die Ängste unangemessen und übertrieben sind. Ängste, die bei den unterschiedlichen Angststörungen auftreten, gehen typischerweise mit einer Vielzahl unterschiedlicher Symptome einher. Typische körperliche Symptome sind: Herzrasen, Herzklopfen oder ein unregelmäßiger und schneller Herzschlag, Schweißausbrüche, Zittern, Mundtrockenheit, Erstickungsgefühle, Kurzatmigkeit und Atemnot, Enge- oder Beklemmungsgefühl im Hals oder in der Brust, Hitzewallungen, Kälteschauer, Frösteln, Kribbeln der Haut, Finger, Mund oder Lippen, Taubheitsgefühle, Übelkeit oder Missempfindungen im Magenbereich, Bauchschmerzen, Würgereiz, Schwindelgefühle, Unsicherheitsgefühl und Benommenheit sowie schließlich Symptome von Depersonalisation und Derealisation. Typische Gedanken sind die Angst vor Kontrollverlust, »verrückt« zu werden, auszuflippen, umzufallen, zu sterben, einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder epileptischen Anfall zu bekommen.
Читать дальше