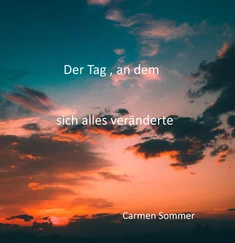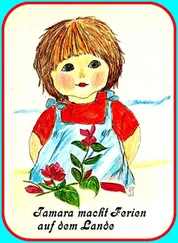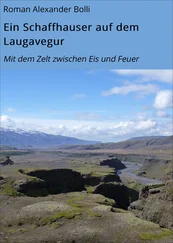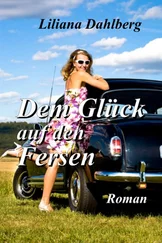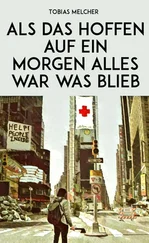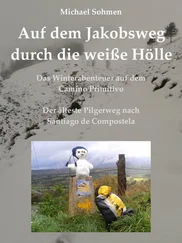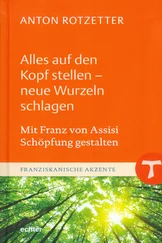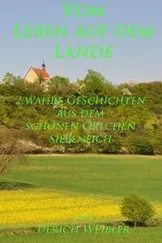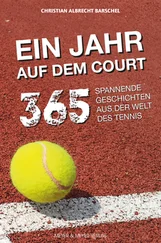Hier wird viel übers Internet kompensiert, durch soziale Netzwerke und Unterhaltungsmedien wie Online-Spiele. Der Breitbandausbau im Land ist aber noch sehr rückständig. Ansonsten organisieren sie sich schon ihre eigene Mobilität, lassen sich von Freunden abholen. Auch nicht motorisierte Mobilität, sprich Fahrrad, ist ganz wichtig.
Welche Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation werden jungen Menschen in ländlichen Räumen geboten?
Viele Landkreise geben sich große Mühe. Oft kommen den Jugendlichen aber die Errungenschaften, die sie durch zähe Verhandlungen erzielen, selbst gar nicht mehr zugute, weil sie dann in einer anderen Lebensphase sind. Und weil die Formate überhaupt nicht jugendorientiert sind, z.B. formalisierte Gremienarbeit, wollen sich nicht so viele beteiligen. Das ist ein doppeltes Dilemma. Gleichzeitig unterschätzen Politik und Verwaltung die Beteiligungsbedürfnisse der Jugendlichen. Es ist absolut unzutreffend, dass sie nur daddeln und in Ruhe gelassen werden wollen. Die Entscheider*innen haben außerdem ein Problem damit, wenn Macht und Verantwortung auseinanderfallen und so ist das tendenziell bei Jugendbeteiligung: Jugendliche haben Mitspracherechte, müssen aber beispielsweise für Budgetentscheidungen nicht selbst geradestehen. Für Entscheidungsträger*innen ist das oft ein Grund, sich davor zu hüten, Macht abzugeben.
Was müsste passieren?
Jugendliche brauchen schnelle Erfolgserlebnisse, wenn es um Partizipation geht. Sie müssen Selbstwirksamkeit erfahren. Sie wollen wissen, was aus ihrer Stellungnahme geworden ist, egal ob erfolgreich oder nicht. Wir empfehlen in solchen Beteiligungsverfahren, mehr auf e-Partizipation umzustellen, weg von der klassischen Gremienarbeit. Jugendliche aus einem ländlichen Raum haben mir mal geschildert, sie suchen einfach einen Ort, den sie nach ihren Vorstellungen gestalten können, ob Jugendraum oder Schrebergarten ist dabei nicht so wichtig. Wichtig ist, dass nicht alles vorgegeben ist. Letztlich ist es auch an der Zeit, mehr in eine Art aufsuchende Partizipation einzutreten, weil eben die herkömmlichen Beteiligungsformate für Jugendliche einfach nicht passen oder zu hochschwellig sind.
Wir danken der kubi-Redaktion und FrankTillmann für die Nachdruckgenehmigung. Erstveröffentlicht in: kubi. Magazin für Kulturelle Bildung, Nr. 18 „Land – alles oder nichts!?“ Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, Berlin 2020, S. 56–59. Das Interview wurde geführt und verfasst von Susanna M. Prautzsch.

Engagementförderung und Demokratiestärkung in ländlichen Räumen – Was sagt die Forschung?
Janine Dieckmann
Christine Eckes
Wissenschaftliche Publikationen und Studien zu Engagement im ländlichen Raum gibt es viele. Doch bisher fehlte es an einem systematischen Blick auf die vorhandenen Ergebnisse der Engagementforschung. Um den aktuellen Stand der Forschung zusammenzufassen, gab das BBE 2018 eine Literaturanalyse zum Themendreieck ‚Engagementförderung – Demokratiestärkung – Ländlicher Raum’ in Auftrag (gefördert vom BMFSFJ im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Lebenty . Mit der Durchführung wurde das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) betraut. In die Literaturanalyse wurden 60 Studien der letzten zehn Jahre einbezogen, die sich mit bürgerschaftlichem Engagement und/oder Demokratiestärkung in ländlichen Räumen befassen. Die Literaturanalyse umfasst eine Zusammenstellung der Hauptergebnisse der Studien sowie die Identifikation von Forschungslücken im Bereich der Engagementforschung.
In der Zusammenschau aller Studien ergaben sich vier Themenschwerpunkte, welche in diesem Beitrag kurz beleuchtet werden: (1) die Bedeutung des Strukturwandels ländlicher Räume für Engagement, (2) das Problem der genauen Begriffsdefinitionen, (3) die fördernden und hemmenden Faktoren für Engagement sowie (4) demokratiestärkende Gegenmaßnahmen in Bezug auf Engagement gegen rechtsradikale Einflüsse und Strukturen. Die gesamte Literaturanalyse sowie die dazugehörige tabellarische Übersicht über die Ergebnisse der analysierten Einzelstudien sind online zugänglich. 1
Bedeutung des Strukturwandels ländlicher Räume
Rahmend für die Entwicklung von Engagement (-strukturen) ist der Strukturwandel ländlicher Räume, der maßgeblich durch den demografischen Wandel bestimmt wird. In den meisten Studien stellt er den Ausgangspunkt für die jeweilige Untersuchung dar.
Die Zentralisierung wirtschaftlicher Aktivitäten in größeren Städten spielt hierbei eine wichtige Rolle: Junge Menschen wandern in Städte ab, da sie dort Bildungsstätten und Arbeitsplätze finden. Vereine, die eine tragende Rolle für das Engagement in ländlichen Räumen spielen, verschwinden. Gleichzeitig verliert die Kirche als traditionelle Trägerin vieler Aktivitäten an Bedeutung. Auch der Um- bzw. Rückbau sozialstaatlicher Aktivitäten in ländlichen Räumen und der Verlust der damit verbundenen Daseinsvorsorge spielen hierbei eine erhebliche Rolle (z.B. Schließung von Schwimmbädern, Schulen, Kindergärten; Mitgliederschwund in Vereinen und freiwilligen Feuerwehren; Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs). Die abnehmende Gewährleistung der Daseinsvorsorge durch den Staat birgt die Gefahr, dass bürgerschaftliches Engagement immer mehr in die Verantwortung gezogen wird: Engagierte sollen dort einspringen, wo der Staat sich zurückzieht. Doch große Teile der neueren Engagementforschung warnen: Engagement kann nicht als beliebig verwendbare Ressource betrachtet werden und den Rückbau staatlicher Infrastruktur ausgleichen.
Das bürgerschaftliche Engagement im ländlichen Raum steht durch demografische und infrastrukturelle Veränderungen vor neuen Herausforderungen und verändert sich: Um entstandene Versorgungslücken und fehlende kulturelle Angebote zu kompensieren, bilden sich einerseits gemeinwohlorientierte Zusammenschlüsse und Hilfsstrukturen, die beispielsweise zum Ziel haben, neue Orte der Begegnung zu schaffen oder die Teilhabe älterer Menschen zu ermöglichen. Andererseits steht das Engagement in ländlichen Räumen vor der Herausforderung, dass durch zunehmend flexiblere individuelle Lebenswege die Langfristigkeit von Engagement abnimmt. Immer seltener engagieren sich Menschen über Jahrzehnte für eine Sache (z. B. als Trainer*innen im Sportverein), da sie z.B. aufgrund beruflicher Entscheidungen eher umziehen. Somit findet individuelles Engagement vermehrt kurzfristiger und situations- oder projektbezogen statt. Gerade in ländlichen Räumen ist jedoch ein kontinuierliches Engagement – beispielsweise in der freiwilligen Feuerwehr – notwendig, um das Funktionieren der Strukturen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten.

Was ist Engagement und Demokratiestärkung – und was nicht?
Durch die Analyse der Studien zeigte sich, dass es in der Forschungslandschaft an einheitlichen Begriffsdefinitionen für Engagement, Ehrenamt, lokalem Aktivwerden und Demokratiestärkung mangelt. So wird der Begriff des Engagements in einigen Studien sehr weit gefasst und dehnt sich bis in informelle Nachbarschaftshilfe aus. In anderen Studien wird er sehr eng gefasst, sodass nur vereinsgebundenes, institutionalisiertes Engagement erfasst wird. Wichtig ist eine differenzierte Definition von Engagement: Es gibt viele Formen von Engagement, die es anzuerkennen und zu untersuchen gilt, doch nicht jedes Engagement ist bürgerschaftliches Engagement. Im Vorwort der Literaturanalyse warnt Prof. Claudia Neu (Universität Göttingen) vor einer Verwässerung des Engagementbegriffs:
Читать дальше